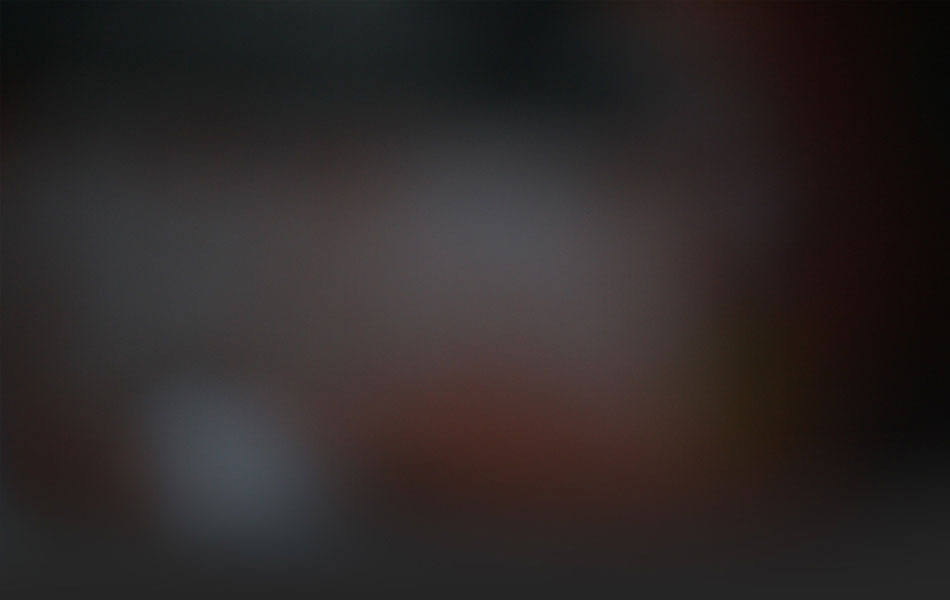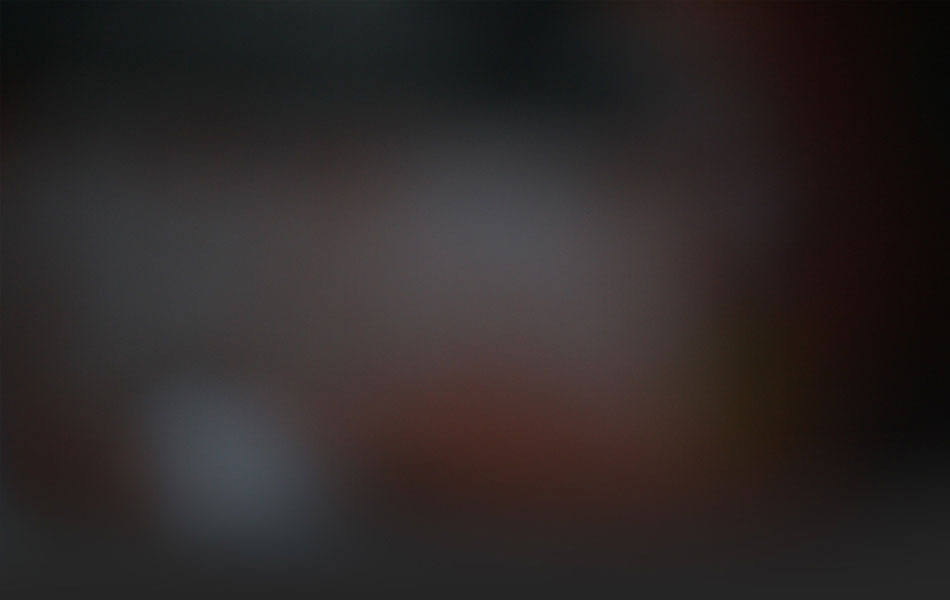Sonntag, der 28. Juni 1914
Eigentlich war das Wetter viel zu schön zum Arbeiten, doch Geld ist ein starkes Argument, und deshalb machte sich Eva Charlotte auf den Weg zum Moritzplatz. Seit sie ihr Abitur in der Tasche hatte, bot ihr ihr Vater manchmal kleine Verdienstmöglichkeiten für Schreibarbeiten in der Redaktion seiner Zeitung. Wenn es nach Eva gegangen wäre, hätte sie auch journalistische Aufgaben übernommen, aber auf einen solchen Vorschlag hatte ihr Vater nur lachend gemeint:
„Was herauskommt, wenn Frauen schreiben, sieht man ja bei Rosa Luxemburg!“
Eva hatte daraufhin – sehr gegen ihren Willen – jede Erwiderung unterdrückt. Denn wenn ihr Vater erfahren hätte, dass sie die berühmt-berüchtigte Sozialistin zu ihrem heimlichen Vorbild erkoren hatte, wäre es ihm womöglich eingefallen, sie nicht einmal mehr zu Hilfdiensten in die Redaktion zu lassen. Zwar war Arthur Hoffmann liberal, ein entschiedener Anhänger der Fortschrittlichen Volkspartei, aber Rosa Luxemburg ging dann doch zu weit, befürchtete seine Tochter.
Als sie am Moritzplatz aus der Straßenbahn stieg, hatte sie den Eindruck, dass der Asphalt der Straße sich zäh und klebrig an die Sohlen ihrer Schuhe heftete. Ihr weißes Kleid hing ihr verschwitzt am Körper. Die angenehme Kühle im Treppenhaus des Redaktionsgebäudes lies sie erleichtert aufatmen. Langsamer als sonst stieg sie die drei Treppen hinauf. Oben würde es wieder heiß und stickig sein. Sie hatte kaum den dritten Stock erreicht, als sie hastige Schritte vernahm und die Tür aufgerissen wurde. Im Türrahmen tauchte Theo Klinger auf, der junge Sport- und Lokalreporter des Stadtanzeigers, schwer atmend wie nach einem 100-Meter-Lauf und offensichtlich außer sich. Als er Eva wahrnahm, verfinsterte sich seine Miene schlagartig. „Ach, sie sind es nur, Evalotte.“
Eva runzelte missbilligend die Stirn. „Haben sie jemand Besseren erwartet?“
„Ihren Vater, Johannsen, ich weiß nicht ...“, stieß Theo hervor. „Hören Sie, Evalotte, wo ist Ihr Vater?“
„Irgendwo im Grunewald. Sonntagsausflug mit Mama und Klein-Alfie.“
Theo stöhnte abgrundtief. Eva trat an ihm vorbei in die Reaktionsräume und legte ihren Hut ab. Er kam ihr hinterher: „Evalotte, seien sie ein gutes Kind, und versuchen sie eine Verbindung mit Johannsen zu bekommen. Wir müssen unbedingt sofort ein Extrablatt herausbringen.“
Extrablätter, das wusste Eva als Verlegerstochter, waren heilige Ereignisse. Sie schluckte alle heftigen Erwiderungen auf das ‚Gute Kind’ herunter und griff zum Telefon.
„Was ist denn passiert?“, wollte sie noch wissen, doch Theo stand schon am Schreibpult, schmierte hastig ein paar Zeilen, strich die Hälfte wider aus und reagierte überhaupt nicht auf ihre Frage. Eva nahm den Telefonhörer ab und ließ sich verbinden. Wenig später meldete sich Chefredakteur Johannsen. Was für ein Glück, dass er zu alt war, um bei dieser Hitze einen überflüssigen Schritt vor die Tür zu tun. Jeder Jüngere hätte sich am Wasser oder im Wald vergnügt. Wilhelm Johannsen klang denn auch sehr verwundert, dass jemand an einem solchen Sonntagnachmittag etwas von ihm wollte.
„Hier ist Eva Charlotte Hoffmann, Herr Johannsen. Herr Klinger möchte sie sprechen. Scheinbar ist eine sensationelle Nachricht eingetroffen und er möchte ein Extrablatt...“
Theo riss ihr den Hörer aus der Hand. „Hier Klinger. Hören Sie, wir müssen uns sofort an ein Extrablatt machen. Ein Attentat … Der österreichische Thronfolger … Ja … Ja, ja, er ist tot ... Ja natürlich ... Das ist anzunehmen! … Ganz recht! ... Auf jeden Fall! ... Ja, werde ich veranlassen ... Ja, sie können sich auf mich verlassen.“ Er knallte den Hörer energisch auf die Gabel. „Evalotte, schönes Kind, sehen Sie sich in der Lage, in die Druckerei rüberzugehen und Bescheid zu geben, dass die Jungs sich auf ein Extrablatt gefasst machen sollen? Und Gerbert oder Hinze oder wer immer da ist, soll Leute zum Verteilen organisieren.“
Eva nickte gehorsam, griff nach ihrem Hut und lief runter über den Moritzplatz zum Druckhaus in der Oranienstraße. Dabei nahm sie sich vor, es ihrem Vater in Rechnung zu stellen, dass sie sich um seines Extrablattes willen unwidersprochen von Theo eine Frechheit nach der anderen gefallen ließ.
Doch das Wort ‚Extrablatt’ verwandelte auch im Druckhaus die Männer, die bis dato einen ruhigen Sonntagsdienst mit Karten und Bier verbracht hatten, in eine Schar wilder Hummeln.
„Was’n passiert?“
Eva zuckte mit den Schultern. „Ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger.“
Sofort hagelte es Fragen und Kommentare:
„Isser tot?“
„Wat denn, der Franz Ferdinand is tot?“
„Wer isses denn det jewesen?“
„Erschossen, oder wat? Oder ham se ’en abjestochen?“
„De olle Kaisa hat aba ooch wenich zu lachen. Is ja nu schon der zweete Thronfoljer, wo eem hops jeht.“
„Mit den Östreicha is nüscht mehr los, sach ick dir. Die ham ihre besten Taje jesehn.“
Doch lange hielten sich die Männer nicht mit dem Palaver auf. Der Setzer begann den Druckstock vorzubereiten. Zwei machten sich an den Druckmaschinen zu schaffen. Einer ging, Verstärkung herbeizutrommeln. Es dauerte nicht lange, bis auch Theo Klinger hereinstürzte. Außer Atem, ohne Hut und Jacke. Er wedelte mit einem Blatt Papier.
„Es kann losgehen, hier ist der Text!“
Der Setzer nahm ihm das Blatt aus der Hand, ging an den Typographen und begann in Windeseile, die Seite zusammenzubasteln. In der Halle nebenan wurden die Druckmaschinen in Bewegung gesetzt. Immer noch schwer atmend, aber befriedigt betrachtete Theo Klinger die hektische Betriebsamkeit:
„Wenn wir Glück haben, sind wir die Ersten. Wenn die Leute von ihren Ausflügen zurückkommen, werden wir schon verteilen können. Die werden Augen machen!“
„Was ist denn nun eigentlich passiert?“ Eva ließ sich ihre ganze Skepsis ob Theos Eifer anmerken. „Sie haben ja einen Rummel veranstaltet, als wäre ein Krieg ausgebrochen.“
„Nun vielleicht kommt das ja auch noch“, gab der zufrieden zurück. „Weiß man nie!“
„Was?“, schrie Eva schockiert. Theo sah prompt noch zufriedener aus und Eva war sofort klar, dass seine Bemerkung kaum ernst gemeint gewesen sein konnte.
„Na, wenn auf dem Balkan was passiert, dann kann man nie wissen. Da wird’s immer brenzlig“, beharrte der junge Reporter aber. „Und den Österreichern, denen ist auch nicht zu trauen. Die werden bestimmt nach Rache dürsten. Seine Frau hat’s übrigens auch erwischt. Sie wissen schon, die Hohenburg, diese ehemalige Kammerfrau der Kaiserin.“
Eva blieb bei der Sache: „An wem wollen sich die Österreicher rächen? Weiß man denn schon, wer den Thronfolger umgebracht hat?“
Sie erntete einen mitleidigen Blick: „Junge Dame, wer verübt auf dem Balkan schon Attentate? Die Serben natürlich! Wieder einer von diesen radikalen Studenten, die auch versucht haben, Baron Cuvaj umzubringen und all die anderen: General Vareschanin, Scerlecz, wie sie alle heißen ... Aber das wird Ihnen nichts sagen“
„Meinen Sie?“, versetzte Eva spitz. „Mir sind diese Namen durchaus ein Begriff und ich weiß sogar, dass die Attentäter keine Serben waren, sondern Bosnier und Kroaten, also österrichisch-ungarische Untertanen.“ Zwar erinnerte sie sich nur dunkel an die genannten Ereignisse, aber sie hatte noch die sarkastischen Kommentare ihres Vaters im Ohr, dass die Österreicher alles täten, sich ihre Attentäter selber heranzuziehen.
Theo jedoch konnte über diese Antwort nur den Kopf schütteln. „Es weiß doch nun wirklich jedes Kind, dass ganz Bosnien von serbischen Agitatoren unterwandert ist. Da braucht man nicht lange raten, um zu wissen, wer wirklich hinter dem Attentat steckt.“
Eva sah ihn fassungslos an: „Sie wissen also nichts! Gar nichts! Aber Sie behaupten einfach, Serbien würde dahinter stecken. Wissen Sie was? Wenn morgen alle titeln ‚Serbien lässt Franz Ferdinand umbringen’ dann glaube ich auch, dass es Krieg geben wird!“
Theo wollte gerade zu einer Verteidigungsrede ansetzen, als Chefredakteur Johannsen hereinkam. „Wie steht et? Die Maschinen loofen schon? Jut, jut! Sie sind een braver Junge, Theo!“ Er erblickte Eva. „Sie ooch hier, Fräulein Hoffmann? Na, denn habense ja mal jesehn, wie det bei uns zujeht, wenn richtig wat los is.“
Eva wollte einwerfen, dass das Extrablatt auch dank ihrer Mithilfe so schnell in den Druck gegangen war, doch der alte Mann redete schon weiter. „Hab et schon jehört, wat passiert ist. Schlimm, schlimm, der arme Kaiser Franz! Ist et wahr, dass man den Täter erwischt hat?“
„Theo meint, das Ganze sei ein Kriegsgrund“, mischte Eva sich boshaft ein.
Ihr Opfer sah auch sehr verlegen aus, als Wilhelm Johannsen lachte. „Krieg? Na, so wild wird’s wohl nüscht kommen. Machense jungen Damen mal keene Angst, Theo!“
„Aber Serbien ...“, versuchte der sich zu verteidigen. „Vor zwei Jahren ist es doch auch ganz schön gefährlich geworden, als Österreich und Serbien aneinander geraten sind.“
„Nu, da war det Problem ja ooch een wenig anders jelagert. Jottlob, liegt Sarajewo ja nich in Serbien, sondern innerhalb der österreichischen Jrenzen. Da wird det Janze wohl ’ne k.u.k.-Anjelegenheit bleiben. Könnt mir allerdings vorstellen, dat die Regierung dat Attentat zum Vorwand nimmt, in Bosnien mal so richtig uffzuräumen und det allet.“
„Dürfte ja auch nicht unangemessen sein“, bemerkte Theo süffisant.
Der alte Johannsen seufzte: „Wird ma sehn, wat draus wird. Lass uns an die Arbeit jehn. Werden wohl bald neue Nachrichten eintreffen. Sind’se mal so nett, Fräulein Eva, und versuchen 'se, ihr'n Vater zu erreichen, und schicken ooch een Boten zum Paul, zu Herrn Zimmermann, meen ick?“
Es war gegen halb fünf, als Arthur Hoffmann, der Verleger des Stadtanzeigers, seine Frau mahnte, an den Aufbruch zu denken. „Bald werden alle fahren. Dann kriegen wir keine Droschke mehr oder stehen ewig im Gedränge. Außerdem möchte ich noch kurz in der Redaktion nach dem Rechtem sehen. Dann braucht auch Eva nicht die Bahn zu nehmen.“
Magda Hoffmann dachte an den Umweg, den es bedeutete vom Grunewald über den Moritzplatz nach Charlottenburg zu fahren, aber sie nickte ergeben und machte sich daran, ihren fünfjährigen Sohn Alfred zu suchen, der sich irgendwo hinter dem Ausflugslokal mit ein paar anderen Kindern herumtrieb und seinen Sonntagsananzug mit Matsch beschmierte. Seine Mutter seufzte, als sie ihn abgerissen und freudestrahlend fand. Manchmal sah sie voller Neid, wie andere Kinder stocksteif und artig den ganzen Nachmittag auf ihren Stühlen saßen, nichts als ‚Ja, Mama’ und ‚Aber gerne, Papa’ sagten und dabei hübsch sauber bleiben. Aber natürlich waren weder Alfie noch Eva je zu so etwas gezwungen worden. Sie hatte ein weiches Herz und ihr Mann war Anhänger von modernen Erziehungstheorien.
Besagter Mann hatte bereits gezahlt und wippte ungeduldig auf den Fußballen hin und her. Als er seinen zerzausten Sohn sah, lächelte er: „Na, junger Mann, wie siehst du denn aus? Willst du mal Räuber werden?“
Alfie lachte schaudernd: „Räuber werden doch eingesperrt, weil sie böse sind.“
Die Familie hatte Glück und fand gleich eine Droschke. Arthur Hoffmann lehnte sich aufatmend zurück. „Nichts schlimmer, als wenn der Sonntagsausflug mit einer lästigen, langen Heimfahrt endet.“
Als sie sich jedoch dem Wittenbergplatz näherten, begannen sich die Wagen zu stauen.
„Also doch noch“, seufzte der Verleger und begann mit den Fingern gegen den Verschlag der Droschke zu trommeln. Dann sprang er plötzlich auf. „Magda“, rief er erregt. „Da ist was passiert. Siehst du, sie verteilen Zeitungen!“
Jetzt waren auch die heiseren Schreie der Zeitungsjungen zu hören:
„Extrablatt, Extrablatt!“
„Franz Ferdinand mit Frau ermordet.“
„Schauerliches Attentat!“
„Mord in Sarajewo!“
„Extraausgabe des Berliner Tageblattes!“
„Gemeine serbische Bluttat!“
Hastig riss Arthur Hoffmann den Bogen an sich, den ihm einer der Jungen reichte. „Die Vossische! Siehst du irgendwo unser Blatt, Magda?“
Er gab dem Kutscher ein Zeichen zum Anhalten und stürzte sich in das dichte Gedränge, das sich auf den Bürgersteigen um die Zeitungsverteiler gebildet hatte. Seine Frau blickte ihm leicht amüsiert nach, dann griff sie nach dem Extrablatt der Vossischen Zeitung, das er achtlos beiseite geworfen hatte.
„Was ist passiert?“, quengelte Alfred.
„Der Thronfolger von Österreich ist erschossen worden.“
„Totgeschossen?"
„Ja, leider.“
„Au backe“, brachte Alfie seinen neuen Lieblingsausdruck an.
Endlich kam Arthur Hoffmann glückstrahlend zurück. Er hatte ein Extrablatt seiner Zeitung ergattern können.
„Auf unsre Jungs kann man sich eben verlassen“, meinte er zufrieden.
„Aber die Nachricht ist ja furchtbar“, gab seine Frau zurück. „Wie konnte das nur passieren? Ich will es gar nicht glauben.“
„Ja, ein schwerer Schlag für Österreich“, stimmte ihr Mann zu. „Jetzt wird das Geschrei wieder losgehen. Aber wenn du mich fragst, meine Liebe, dann meine ich, die Österreicher sind irgendwo selbst schuld. Die lassen alles vor sich hinlaufen, wie es eben läuft, und wenn dann etwas passiert, dann schreien sie nach Krieg und Rache und schlagen blindlings drauf los. So kann man keine Politik machen.“ Er beugte sich zu dem Kutscher vor. „Fahren sie los, Mann, ich muss schnellstens in die Redaktion!“
Montag, der 29. Juni 1914
Eva Charlotte saß noch am Frühstückstisch, als ihre Freundin Lea Goldberg gemeldet wurde. Die Morgenblätter mit den Berichten über das Attentat hatte sie schnell beiseite gelegt. Zwar nahmen die Artikel viele Seiten ein, doch allzuviel Neues stand nicht darin. Der Thronfolger und seine Frau waren auf der Fahrt durch die Stadt erschossen worden, nachdem es vorher schon einen missglückten Bombenanschlag gegeben hatte. Beide Attentäter waren von der Menge gestellt und festgenommen worden. Sie hießen Gabriel Princip und Nedjelko Gabrinowitsch, waren 19 und 20 Jahre alt, Bosnier serbischer Nationalität, ein Handelsschüler und ein Buchdrucker, beide schon als ‚Anarchisten’ aufgefallen und erst vor kurzem aus Belgrad zurückgekehrt. Weitschweifige Berichte, wo genau die Kugeln eingedrungen waren, welcher Zeuge aus welchem Blickwinkel welches Detail wahrgenommen hatte, und die Beileidstelegramme aus aller Welt interessierten Eva wenig. Sie hatte sich mittlerweilen das Berliner Tageblatt vorgenommen und studierte die Heiratsanzeigen.
„Wie findest du das?“, fragte sie Lea. „’Gebildeter, vornehm denkender Kaufmann sucht Frau mit mindestens 100.000 Mark Vermögen’. Findest du das vornehm?“
Lea kicherte: „Im Tageblatt sind sie am schlimmsten. Manchmal steht da nichts außer der Summe, die sie erwarten. Ich finde die ganz Eitlen lustiger.“
„’Schöner siebenundzwanzigjähriger Molkereidirektor in spe’, möchte neben Heirat auch Kaution“, zitierte Eva. „Oder: ‚Inserent sucht Frau für seinen Neffen, mosaisch, gesund, repräsentativ, von makellosem Äußeren, aus achtbarer Familie...’“
„Klingt wie eine Opfervorschrift aus der Tora“, spottete Lea. „Man nehme ein zweijähriges Lamm, ein männliches, fehlerloses Tier …“
„Wenn einer seinen Onkel für sich suchen lässt, ist er vom Opferlamm auch nicht mehr weit entfernt“, lautete der abfällige Kommentar ihrer Freundin. „Ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, dass in Verlobungsanzeigen die Frauen noch an erster Stelle stehen, in Heiratsanzeigen aber immer an zweiter?“
„Und in den Geburtsanzeigen bekommen die Männer die Kinder“, ergänzte Lea trocken. „Die Geburt eines strammen Stammhalters beehrt sich hocherfreut anzuzeigen, Oberamtsbuchhalter Sowieso nebst Gattin. Als hätte sie nichts damit zu tun.“
„Manchmal glaube ich wirklich, drei Viertel der Menschheit oder mehr haben noch nicht gemerkt, dass inzwischen ein neues Jahrhundert angefangen hat“, meinte Eva. „Am Samstag musste ich mit den Eltern zu Bekannten von ihnen, Senatsrat Lang nebst Gattin. Fragte er doch ‚Und das Fräulein Tochter ist noch nicht verlobt?’! Sagten meine Eltern, milde lächelnd: ‚Das hat doch noch ein wenig Zeit. So schnell wollen wir sie gar nicht hergeben.’ Ergänzte ich mit dem brävsten Lächeln: ‚Ich habe gerade erst mein Abitur gemacht.’ Du hättest sehen sollen, wie da die Augenbrauen in die Höhe schnellten! Man räusperte sich verlegen, sagte ‚Soso!’ und behandelte mich von da ab mit mühsam unterdrückter Missbilligung. Ich hätte ja noch gerne ergänzt: ‚Und zum Herbst werde ich mein Studium aufnehmen.’ Aber mir ist kein geeignetes Fach eingefallen. Nur Jura und Medizin. Das hätte ein Hallo gegeben. Der alte Lang hätte mir mit Sicherheit tausend Gründe entgegen geschleudert, warum eine Frau von Natur aus nicht zur Ärztin oder Anwältin taugt, und meine Entgegnungen darauf wollte ich Mama und Papa doch nicht antun, auch wenn sie die Langs selber nicht gerade lieben.“
„Du hast wirklich Glück mit deinen Eltern“, seufzte Lea neidvoll. „Dass sie dich studieren lassen würden …“
„Man muss sagen, sie haben den Sprung ins 20.Jahrhundert ganz achtbar getan“, gab Eva zu. „Aber was nützt mir das? Ich will nicht studieren. Ich will Journalistin werden. Und das erlauben sie mir nicht. Alle Andeutungen meinerseits wurden jedenfalls bislang immer schnell abgetan oder ins Lächerliche gezogen. Dabei könnte ich das, was so ein Theo Klinger zusammenbekommt, allemal schreiben. Ich habe meinen Eltern sogar schon mal angedroht, dass ich in die SPD eintrete, wenn ich volljährig bin, und für den Vorwärts schreibe. Papa hat sich vor Lachen an einer Fischgräte verschluckt und wäre um ein Haar erstickt.“
„Nun ja“, meinte Lea. „Du willst das ja auch nicht wirklich tun.“
„Man verdient damit zuwenig“, konstatierte Eva. „Selbst Rosa Luxemburg wurde lange von einem reichen Genossen der Lebensunterhalt finanziert, habe ich gehört. Genug Geld bekommen nur die, die über die belanglosen Skandale schreiben.“
„Hast du von dem Mord gelesen?“, erkundigte sich Lea.
„In Sarajewo? Das ist ja nicht zu übersehen!“
„Nein, im Falkenhagener Forst wurde eine Frau ermordet. Eine Schneiderin aus Spandau. Vom Mörder fehlt noch jede Spur. Wenn ich daran denke, dass wir erst vor zwei Wochen genau dort gewandert sind! Ich finde das schon schaurig.“
„Kein Mörder auf der Welt wird eine ganze Horde Wandervögel auf einmal angreifen“, gab Eva gelassen zurück. „Aber wenn ich schon Wandervogel sage... Mir ist bei unserem letzten Nestabend etwas wahrhaft Schauerliches passiert. Du musst dir wirklich Vorwürfe machen, dass du nicht da warst und mich davor bewahrt hast.“
„Was? Erzähle!“ Leas Gesicht drückte freudige Neugierde aus. „Hat es mit einem gewissen Moritz Odenwald zu tun?“
Eva bremste die Freundin mit einem bitterbösen Blick, fing aber gleich darauf zu berichten an: „Es hat mit unserer lieben Else zu tun. Elschen kam ganz glückstrahlend und ungewohnt lebhaft zum Treffen und platzte gleich mit einer famosen Idee heraus: Man könnte doch neue Vorhänge für das Nest nähen. Einige – Inge, Lotti und so weiter – fanden auch, dass das ein wirklich guter, netter Vorschlag sei. Der Rest dachte sich ‚Soll Elschen doch Vorhänge nähen, wenn sie unbedingt will’ und so war es beschlossene Sache. Es gab nur ein Problem: Wer kauft ein? Na, das könne Elschen wohl am besten selber, sagte ich. Doch die war völlig entsetzt und meinte, sie könne doch nicht alleine in die Stadt gehen. Ich würde dergleichen doch bestimmt auch nicht tun. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und erklärte, dass ich nicht meine Mama brauche, um in ein Kaufhaus zu gehen. Kurz und gut, das Ende von dem Lied war, dass ich verpflichtet wurde, mit Elschen Vorhangstoff zu kaufen.“
Lea lachte Tränen: „Oh, ich kann mir lebhaft vorstellen, wie ihr zwei bei Tietz oder Wertheim steht: ‚Sag Eva, sollten wir diesen Batist nehmen? Oder vielleicht doch den bedruckten Musselin? Er lässt sich schöner nähen, wenn er auch nicht so gut zu den Sitzpolstern passt.’ Du wirst dir überlegen, wie du sie ermorden kannst!“
Das Attentat war natürlich aller Orten das Thema des Tages. Die meisten Gespräche darüber beschränkten sich allerdings auf ein gegenseitiges Versichern, wie schrecklich man das alles finde: „Ganz furchtbar, nicht wahr?“
„Oh ja so entsetzlich! Man mag es sich gar nicht vorstellen.“
Oder man rekapitulierte miteinander die sattsam bekannten Fakten aus den Zeitungen: „Die Fürstin soll ja noch im Wagjen verblutet seen.“
„Ja, und den Erzherzog haben sie in den Hals geschossen.“
„Es heißt, der Attentäter wäre von der Menge fast gelyncht worden.“
„Det hab ich ooch jelesen.“
Vor allem Männer ergingen sich aber auch in Kommentaren wie „Todsicher, dass da die Serben dahinter stecken“, „Na, von denen ist ja nichts anderes zu erwarten“ oder „Es wird Zeit, dass die Österreicher denen mal ordentlich den Marsch blasen.“
Nachdem sie sich den ganzen Tag über dergleichen hatte anhören dürfen, beschloss Eva, ihren Vater am Abend in der Redaktion abzuholen, um an bessere Informationen zu kommen.
Sie hörte Theos aufgeregte Stimme, kaum dass sie die Reaktionsräume betreten hatte. „Das ist wirklich eine Sensation, unglaublich!“
„Was Neues über das Attentat?“, fragte sie begierig.
Theo fuhr herum. „Äh … nein“, machte er irritiert. „Ein neuer Weltrekord im Dauerflug. Stellen Sie sich vor, da ist einer 21 Stunden und 49 Minuten in der Luft geblieben. Werner Landmann heißt er, ein Deutscher. Vorher hatte ein Franzose den Rekord. Denken Sie nur: Landmann ist 1900 Kilometer geflogen. Das ist so lang, wie von hier bis nach Madrid. Ein verrückter Gedanke, dass man bis Madrid fliegen kann. Das muß man sich einmal vorstellen! In was für einer Zeit wir leben!“
Eva interessierte das wenig. „Gibt es etwas Neues über das Attentat?“, beharrte sie.
Paul Zimmermann, der politische Redakteur, ein sehr ruhiger und ernsthafter junger Mann, zuckte mit den Achseln. „Zum Attentat selber wenig. Es hat ein paar weitere Verhaftungen gegeben, aber eigentlich keine neuen Erkenntnisse. In einigen Städten muss es allerdings zu antiserbischen Ausschreitungen gekommen sein und über Bosnien und die Herzegowina wurde daraufhin das Standrecht verhängt. Natürlich haben Mutmaßungen angefangen, ob der für Bosnien zuständige Minister Bilinski abgelöst wird. Außerdem haben sich die Bomben als serbisches Fabrikat herausgestellt.“
„Damit stehen die Drahtzieher ja ziemlich eindeutig fest“, fiel Theo ein. „Oder zweifeln sie noch immer, Fräulein Evalotte?“
„Wenn es deutsche Bomben gewesen wären, hätten sie dann an ein deutsches Komplott geglaubt?“, versetzte Eva bissig. „So ein Attentäter nimmt doch, was er bekommt.“
Theo lachte auf: „Wie sollen denn ein paar armselige Balkanattentäter zu deutschen Bomben kommen?“, fragte er und schenkte ihr ein mitleidiges Lächeln.
Prompt mischte sich sein Kollege Bruno Novis ein: „Man kauft sie. Auf dem Balkan wimmelt es von deutschen Bomben.“
Paul bestätigte: „Serbien und die anderen Balkanstaaten sind wichtige Exportländer für unsere Produkte, vor allem auch für Waffen.“
Theo sah nun doch beschämt aus, doch Eva konnte den Triumph nicht auskosten. „Wir verkaufen tatsächlich Waffen an Serbien?“, erkundigte sie sich entsetzt.
Die Männer um sie herum, ihr Vater eingeschlossen, nickten.
„Es ist nicht nur so, dass deutsche Waffen nach Serbien gelangen, sondern wir verkaufen Waffen direkt an die Serben?“, hakte sie trotzdem noch einmal nach.
Erneutes Nicken.
„Aber was sagen diese ganzen Kriegshetzer dazu? Die, die ständig erklären, Serbien müsse endlich geduckt und geschurriegelt werden, weil es Österreich bedroht? Warum protestieren die nicht, wenn jemand den Serben auch noch Waffen liefert?“
Bruno grinste breit: „ Es sind dieselben, Fräulein Hoffmann, es sind dieselben.“
Eva vermutetete, dass sie ihn ziemlich entgeistert anstarrte. Bruno dagegen sah aus, als würde ihm diese ungeheuerliche Tatsache auch noch Spaß machen. Wahrscheinlich war es so. Bruno Novis war eigentlich der Kulturreporter des Stadtanzeigers. Nicht älter als Theo und Paul, aber ein gnadenloser Zyniker. Möglicherweise weil er verkrüppelte Beine hatte und sich auf Krücken durchs Leben schleppen musste. Wenn Bruno aber wieder einmal ein Theaterstück, eine Balletaufführung oder einen Lichtspielfilm mit einer seiner bissigen, brillanten Kritiken bedachte, ließ Arthur Hoffmann immer eine höhere Auflage drucken, weil dann auch zahlreiche Menschen sein Blatt kauften, die den kleinen Stadtanzeiger normalerweise nicht beachteten.
Auch Eva las Brunos Texte normalerweise mit großem Vergnügen, aber im Moment zweifelte sie an seinem Verstand. Sie blickte hilfesuchend zu ihrem Vater, doch dessen unwillig-verlegener Gesichtsausdruck machte ihr klar, dass Bruno nicht ganz Unrecht haben konnte. Auch Paul sah aus, als würde er gerne protestieren, aber nicht über die rechten Argumente verfügen.
„Aber im vergangenen Jahr haben doch alle gesagt, dass es wegen Serbien vielleicht zu einem Weltkrieg kommen könnte“, setzte Eva noch einmal an. „Wie kann man Serbien einerseits so fürchten und ihm andererseits Waffen verkaufen?“
Bruno grinste wieder: „Die Chefs von Krupp und anderen Firmen müssten ja nicht selber in den Krieg ziehen, sondern würden stattdessen noch mehr Waffen verkaufen können.“
Sein Chef fühlte sich nun doch berufen, einzugreifen: „Schluss, Bruno“, erklärte Arthur Hoffmann bestimmt. „So, wie sie das darstellen, ist die Lage nun wirklich nicht. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass einige der übelsten Chauvinisten und Hetzer im Lager der Waffenschmiede und Stahlproduzenten sitzen. Andererseits ist die Schwerindustrie immer noch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und braucht genauso Absatzmärkte wie jedes andere Gewerbe. Es ist ja auch nicht so, dass Serbien Kriegspläne gegen Deutschland oder Österreich hegt. Der ganze Schlamassel auf dem Balkan kommt doch nur daher, dass – umgekehrt – unsere österreichischen Freunde immer wieder von dem Wunsch gepackt werden, die großserbische Hetz-und Wühlarbeit mit Waffengewalt zu beantworten.“
„Ich finde trotzdem, dass die Regierung den Mumm haben müsste, Waffenverkäufe an unsere potentiellen Feinde zu verbieten“, mischte sich Paul ein.
Bruno brach in Hohngelächter aus: „Paulchen, wer will denn das? Selbst die SPD würde Zeter und Mordio schreien, weil es Arbeitsplätze kosten würde.“
Eva setzte zu heftigem Protest an – ungeachtet der Gewissheit, dass sie mit ihrer wagen Überzeugung, dass die SPD auf Seiten der Friedensfreunde stand, Brunos scharfer Zunge wahrscheinlich nicht gewachsen war.
Doch ihr Vater war schneller: „Nun, wie auch immer“, versuchte er aufkeimenden Streit zu unterdrücken. „In letzter Zeit haben uns die Franzosen auf dem Balkan ganz schön den Rang abgelaufen, gerade auch Schneider-Creusot mit seinen Waffen.“
„Das allerdings“, gab Paul mit hörbarem Sarkasmus zu. „Mit den französischen Banken als Türöffner. Lukrative Bau- und Rüstungsaufträge gegen günstige Staatskredite.“
"Ist das verurteilenswert?", erkundigte sich Eva vorsichtig. Mit Banken und Krediten kannte sie sich gar nicht aus.
Sie bekam ein Feixen von Bruno. "Das ist vollkommen normal. Unsere Banken täten das auch, wenn sie könnten. Aber da sie gezwungen sind, ihre ganzen Geldbestände für Kredite Kredit für unsere glorreiche Flotte und an unsere noch glorreicheren österreichischen Verbündeten zu geben, gehen ihnen langsam die Reserven aus."
Arthur Hoffmann holte schon tief Luft und Eva fürchtete, ihr Vater würde zu einer seiner gefürchteten Wutreden gegen die deutsche Flottenpolitik ansetzen. Doch der Redaktionsdiener, der die druckfrischen Abendausgaben der Konkurrenz brachte, unterbrach die Diskussion.
Obenauf lag das renommierte Berliner Tageblatt, das natürlich für Arthur Hoffmann reserviert war. Seine Tochter hätte sich gerne den Vorwärts geschnappt, doch Paul war schneller. Auch die anderen Männer griffen geradezu begierig zu und verzogen sich mit ihrer Beute an die Tische und Pulte. Für Eva blieben nur wenig Interessantes wie die Germania oder die Norddeutsche Allgemeine Zeitung liegen. Das einzig Bemerkenswerte an der Norddeutschen war, dass sie gelegentlich von der Regierung als Sprachrohr verwendet wurde. Ansonsten zeichnete sie sich durch geradezu bemerkenswerte Langeweile aus. Eva hatte vor einiger Zeit begonnen, den Fortsetzungsroman zu lesen, musste aber feststellen, dass die Norddeutsche es schaffte, Kriminalgeschichten zu bringen, die genauso fade waren wie der übrige Inhalt des Blattes. Ihr genügten wenige Augenblicke, um festzustellen, dass auch die heutige Ausgabe nichts Spannendes enthielt und ihr Glaube, das Ende des Romans schon zu kennen, in Nichts erschüttert wurde. Nachdem sie sich auch noch vergewissert hatte, dass das Attentat der Regierung keinen offiziösen Kommentar wert gewesen war, nahm sich Eva die Germania vor, die der katholischen Zentrumspartei nahe stand und – so das Urteil ihres Vater – von „gefühldusseligen Weihrauchschwingern“ geschrieben wurde. Tatsächlich bezeichnete die Germania das Attentat als eines „der verabscheuenswürdigsten Verbrechen der ganzen Menschheitsgeschichte“ und erklärte pathostriefend: „Die Hoffnung des Donaureiches liegt gebrochenen Auges auf der Bahre, die Freund und Feind gleichermaßen tief ergriffen und erschüttert umstehen.“ Eva war schon nahe dran, sich den Rest des Artikels zu ersparen, als der Schreiber auf die mutmaßlichen Hintergründe des Attentats zu sprechen kam: „Es war Belgrader Arbeit, die da ihr verdammenswertes Ziel erreicht hat.“ Dass Serbien Ablösungsbestrebungen in den südslawischen Gebieten der Donaumonarchie reichlich unterstütze und die großserbischen Agitatoren mit Belgrader Kreisen in engen Zusammenhang ständen, sei eine nicht wegzuleugnende Tatsache, hieß es. Zwar hüte sich die offizielle Seite, dieses hochverräterische Treiben zu unterstützen, doch die serbische Presse führe dafür eine umso beredtere Sprache. Erst vergangenes Jahr hätten serbische Blätter erklärt, der nächste Krieg werde Österreich gelten. Eva fühlte wachsenden Ärger. Was sollte das? Entweder waren die Serben gefährlich. Dann sollte man ihnen keine Waffen verkaufen. Oder sie waren es nicht. Dann war es auch nicht gerecht, irgendwelche Behauptungen rechter Hetzblätter zum Beweis zu nehmen, dass Serbien das Attentat veranlasst hatte.
Sie schenkte sich die langatmigen Augenzeugenberichte, die unter der Überschrift „Wie der Erzherzog starb“ abgedruckt waren, und begann ungeduldig zu beobachten, wie ihr Vater mit sehr zufriedenem Gesichtsausdruck und immer wieder einem beifälligen Nicken die Spalten des Tageblatts durcharbeitete. Paul Zimmermann dagegen war sein wachsender Ärger über das, was der Vorwärts schrieb, deutlich anzumerken. Bruno überflog die Deutsche Tageszeitung, vom Bund der Landwirte herausgegeben und äußerst rechts angesiedelt, unter fortwährendem Kichern. Theo dagegen schien eher gelangweilt von dem, was die Kreuzzeitung, das Sprachrohr von Adel und Militär, zu berichten hatte. Als erster war jedoch Chefredakteur Wilhelm Johannsen fertig. Er hatte sich ernst und konzentriert durch die altehrwürdige Vossische Zeitung gearbeitet und griff nun zur Norddeutschen, was Eva in den Besitz von „Tante Voss“ brachte.
„Auf dem Senatsplatz vor dem Justizgebäude zu Moskau stand in finsterer Nacht, in eine Ecke gedrückt ein Mann …“, las sie dort zu ihrer Verblüffung, „…die Hand mit der verheerenbringenden Bombe zum Wurf erhoben.“ Das klang ja wie ein Krimi! Und noch dazu nach einem besseren als in der Norddeutschen! Doch dann enthüllte die Vossische, dass sie von realen Eereignissen sprach, nämlich der Ermordung des russischen Großfürsten Sergius im Jahr 1905. Damals habe der Attentäter, als er erkannte, dass neben dem Großfürsten dessen Frau saß, sein Vorhaben abgebrochen und die Bombe erst am nächsten Tag geworfen, als der Großfürst alleine im Wagen war. „Das Mitgefühl, das den russischen Revolutionär beschlich, ist serbischen Herzen fremd“, schlug der Redakteur den Bogen nach Sarajewo, um dann von „alteingewurzeltem serbischen Verschwörertum“ und „Blutrausch“ zu reden. Eva konnte nur noch den Kopf schütteln. Sie hatte Tante Voss bisher für eine liberale Zeitung gehalten, wenn auch eine, die „bei den Forderungen von 1848 stehen geblieben sei“, wie ihr Vater gerne spottete.
„Dann lasst uns mal“, unterbrach dieser die allgemeine Lektüre. „Bruno, erzählen uns, was sie an er DTZ so belustigt!“
„Das Attentat ist eine Mahnung an alle Kulturstaaten gegen die moralische Erkrankung zu rüsten, die sich in der ketzerischen Untergrabung aller Zucht und Autorität auf Erden zeigt“, zitierte der Angesprochene genüsslich.
„Wen meinen die damit?“, platzte Eva heraus.
Bruno kicherte wieder: „Den Sozialismus, meine Teuerste! Den Sozialismus.“
„Was?“ Arthur Hoffmann fuhr erstaunt auf. „Gibt es irgendwelche Hinweise auf einen sozialistischen Hintergrund der Tat? Davon sagt sonst keiner etwas!“
„Nun“, dozierte Bruno mit breitestem Grinsen. „Das lässt sich – laut der DTZ – aber leicht aus der Tatsache erkennen, dass der Vorwärts die Tat nicht gerade scharf verurteilt. Dies sei doch Beweis genug, dass auch dieses Attentat auf dem Boden infernalischer Feindschaft gegen jede staatliche Zucht und Ordnung entstanden sei, und wie alle Meuchelmorde an leitenden Staatspersonen im sozialdemokratischen Kalender als Etappe zu einer größeren Menschheitskultur verzeichnet werde.“
„Das können die doch nicht wirklich schreiben?“, rief Eva entsetzt aus.
Bruno lächelte nur milde: „Mein liebes Kind, haben Sie noch nie DTZ gelesen? So etwas schreiben die immer. Die Serben bekommen natürlich auch noch ihr Fett weckt. Die DTZ listet fein säuberlich die Beweise auf, dass Belgrad hinter dem Attentat steckte. Nämlich Folgendes: Das Attentat wurde dort mit größter Bestürzung aufgenommen. Die öffentlichen Lokale sind abends geschlossen worden. Die führenden Zeitungen haben Beileidsanzeigen veröffentlicht und König, Kronprinz und Regierung haben kondoliert.“
„Und?“, unterbrach Paul verständnislos. „Das sind doch völlig korrekte Reaktionen!“
„Steht hier aber unter dem Titel ‚Das schlechte Gewissen in Belgrad’.“
„Legen Sie den Dreck weg!“, entschied Arthur Hoffmann energisch. „Paul, was schreibt der Vorwärts?“
„Ziemliche Unverschämtheiten.“ Paul Zimmermann wirkte aufgebracht. „Sie verunglimpfen den Toten, nennen ihn einen Reaktionär...“
„War er das nicht auch?“, platzte Eva heraus, was ihr einen äußerst verwarnenden Blick ihres Vaters eintrug.
„Er war vielleicht konservativ, aber bestimmt nicht das Monstrum, als das der Vorwärts ihn darstellt“, entgegente Paul sachlich, aber entschieden. „Im Gegenteil, es war Franz Ferdinand, der immer wieder den chauvinistischen Schreihälsen in Österreich Paroli geboten hat. Und ich könnte mir denken, dass er gerade deshalb ermordet wurde. Denn, wenn es ihm gelungen wäre, in Österreich eine slawenfreundlichere Politik durchzusetzen, hätte das der großserbischen Bewegung die Nahrung entzogen.“
„Laut der Germania“, fiel Eva ein, „ist der allergrößte Teil der bosnischen Bevölkerung, auch der serbischen, aber absolut kaiser- und reichstreu. Angeblich lassen sich nur ein paar Schuljungen von der Hetze aus Belgrad anstecken. Tante Voss dagegen behauptet, dass ein großer Teil der Bosnier in grimmiger Feindschaft zu Österreich steht.“
Bruno lachte spöttisch auf: „Geben Sie nichts auf die Germania, Fräulein Hoffmann!“, riet er. „Die möchte uns immer weiß machen, dass in katholischen Ländern wie Österreich eitel Frieden und Harmonie herrschen.“
Arthur Hoffmann schmunzelte beifällig: „Johannsen, was schreibt Tante Voss denn sonst noch?“, fuhr er dann fort.
„Nu“, begann Wilhelm Johannsen zögerlich. „Sie meent, der Zusammenhang zwischen den Attentätern und Belgrader Hintermännern wär bereits festjestellt. Dann kommen aba erst ma die alten Attentate und det allet, wat schon bekannt is. Sie schreiben aber ooch, dat angjeblich inzwischen an jeder höheren Schule in den südslawischen Teilen von Östreich ein serbischer Jeheimbund aktiv is. Außerdem soll die serbische Orjanisation „Narodna Ochrana“ in allen jrößeren Städten jeheime Vertrauensmänner habn. Die Verbindung dieser Jesellschaft in serbische Militärkreise sei notorisch, heeßt et hier, und mit der Regierung halte man über Mittelmänner Kontakt. Der serbische Jesandte in Österreich, Johanovic, soll sogar ein Hauptorganisator dieser Narodna Ochrana sein.“
Arthur Hoffmann runzelte die Stirn: „Aber wirkliche Beweise werden nicht erbracht?“
„Nee, des nüscht.“
Das brachte Eva schon wieder dazu, alle damenhafte Zurückhaltung zu vergessen. „Das scheint auch niemand für nötig zu halten“, versetzte sie heftig. „Weil die Attentäter Serben waren, scheint für alle Welt festzustehen, dass auch alle Serben Attentäter sind.“
„Das behauptet niemand“, widersprach Paul Zimmermann entschieden.
„Ach nein?“, höhnte Eva. „Und warum schreibt dann Tante Voss mit Bezug auf das Sergius-Attentat von 1905: ‚Das Mitgefühl, das den russischen Revolutionär beschlich, ist serbischen Herzen fremd’? Wenn das nicht heißt ‚Allen serbischen Herzen’, dann könnt ihr mich noch einmal auf die Schule in den Sprachunterricht schicken. Aber nirgends findet sich das kleinste Fitzelchen eines Beweises. Nichts! Alles nur Annahme und Vermutung ohne Grund und Boden!“
Theo lachte: „Was haben ihnen die Serben nur getan, Fräulein Hoffmann, dass sie sie so glühend verteidigen?“
‚Sieh mal an’, dachte Eva. ‚Kaum steht mein Vater dabei, lässt er seine Unverschämtheiten und ich bin wieder Fräulein Hoffmann. Feigling!’ Laut sagte sie: „Es geht nicht um die Serben. Ich kenne keinen und weiß wenig von ihnen. Aber ich bin der Meinung, dass man Gründe und Beweise liefern muß, bevor man jemanden anschuldigt. Das tut hier niemand, jedenfalls nicht in ausreichender Form. Aber überall wird geschrien ‚Serbische Bluttat!’, ‚Großserbische Verschwörung!’. Gehen Sie doch auf die Straße, zum Bäcker, zum Schlachter und fragen Sie, wer Franz Ferdinand umgebracht hat. Da erzählt Ihnen jeder: ‚Die Serben’. Selbst auf deinem geliebten Tagblatt, Papa, erspähe ich den Titel ‚Großserbische Bluttat’.“
„Das ist ja auch etwas ganz Anderes als ‚serbische Bluttat’“, wandte Paul ein. „Dass es eine großserbische Bewegung gibt, die es darauf abgelegt hat, in Bosnien, der Herzegowina und Kroatien einen Aufstand anzuzetteln, der zur Abspaltung dieser Länder von Österreich führen soll, das ist nun mal offenkundig. Und die Attentäter rechnen sich mit Sicherheit dieser Bewegung zu. Inwieweit sie Unterstützung aus Serbien erhielten und wie weit ihre Verbindungen in Regierungskreise reichen, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.“
„Kein Mensch auf der Straße wird zwischen serbisch und großserbisch unterscheiden“, hielt ihm Eva entgegen. „Zumal es auch die Schreiber der Germania und Voss nicht tun. Und dass Österreichs Politik in der Vergangenheit alles andere als klug und freundlich war, sowohl gegen die eigene slawische Bevölkerung wie auch gegen Serbien, das wagt jetzt aus Pietät wohl niemand anzudeuten, oder?“
Paul schwieg und Eva blickte unwillkürlich zu ihrem Vater. Doch statt erneutem Tadel zeigte sich auf dessen Gesicht ein äußerst zufriedenes Lächeln. „Nun, hier zeigt sich wieder einmal die Klasse des Tageblattes“, erklärte er. „Dieser hervorragende Leitartikel hier ist wohl das Beste, was zu der Situation geschrieben werden kann. Er wird auch dir gefallen, Eva. Er beginnt mit der Feststellung, dass die großserbische Bewegung zu wenig ernst genommen worden sei in letzter Zeit, man sich aber auch nicht eingehend mit all den Ungeheuerlichkeiten des österreichischen Regiments in seinen Balkanprovinzen auseinandergesetzt habe. So habe man nur den Kopf geschüttelt als Minister Aerenthal seine Unterdrückungspolitik mit falschen Beweisen rechtfertigen wollte, habe es kaum wahrgenommen, als die Verfassung von Kroatien außer Kraft gesetzt wurde und Baron Cuvaj dort ein absolutistisches Regiment errichtete. Selbst als versucht wurde, ihn zu ermorden, habe man gerade mal kurz aufgehorcht. Die Änderung dieser Haltung sei zu spät erfolgt. Die jetzige, freundschaftliche und schwache Politik des neuen Ministers Bilinski hat nach Ansicht des Tageblatts die Lage nur noch verschlimmert, weil sie der großserbischen Bewegung Raum gab, sich auszubreiten, ihr aber nicht mehr das Fundament, den Hass auf die Doppelmonarchie, habe entziehen konnte. Jetzt werde man Bilinski wohl als Sündenbock hinstellen und Druck machen, der auf jeden Fall Gegendruck erzeugt, und die Gefahr, die von der Situation ausgeht, noch größer werden lässt. Wirklich, ich glaube, besser läßt sich die Lage nicht analysieren!“
„Das alles bezieht sich nur auf die österreichische Politik in den eigenen Balkanprovinzen“, meinte Paul nachdenklich. „An internationale Verwicklungen glaubt der Autor anscheinend nicht?“
„Das halte ich auch für unwahrscheinlich“, warf sein Arbeitgeber ein. „Das ist doch alles in erster Linie ein internes Problem Österreichs.“
„Die Kreuzzeitung meint aber, Österreich solle gegen Serbien diesmal im Gegensatz zu 1912 alle Konsequenzen ziehen“, warf Theo ein.
Sofort hatte er alle Aufmerksamkeit: „Was?“, schrieen Arthur Hoffmann, Wilhelm Johannsen und Paul Zimmermann fast unisono.
„1912, das war doch damals, wie es fast Krieg gab, oder?“, vergewisserte sich Eva entsetzt.
„Nachdem die Balkanstaaten 1912 den Krieg gegen die Türkei gewonnen hatten, wollte Österreich mit allen Mitteln verhindern, dass Serbien sein Territorium bis zur Adria ausdehnt und so im Krisenfall der österreichischen Flotte den Zugang zum Mittelmeer versperren kann“, bestätigte Paul. „Österreich hatte schon mobil gemacht. Ebenso Russland zur Verteidigung Serbiens. Aber die anderen Mächte, allen voran Deutschland und England, haben auf eine friedliche Lösung gedrungen und auf der Botschafterkonferenz von London auch durchgesetzt.“
„Und jetzt meint die Kreuzzeitung, soll Österreich wirklich Krieg gegen Serbien führen, auch wenn vielleicht wieder Russland eingreift?“, hakte Eva immer noch schockiert nach.
„Unsinn“, fiel ihr Vater ein. „Es war doch klar, dass es von Rechts wieder Kriegsgeschrei geben wird. Aber unsere Regierung hat damals Österreich unmissverständlich klar gemacht, dass ihr Serbien keinen europäischen Krieg wert ist, und sie wird es diesmal wieder tun, falls Österreich ähnliche Gelüste verspüren sollte. Falls, wie gesagt!“
„Ich weiß nicht“, gab Paul zu Bedenken. „In Wien hat man sich doch nie wirklich mit den Kompromissen von London zufriedengegeben.“
„Dass die Attentäter serbischer Nationalität sind, ist ja wohl kaum ein Kriegsgrund“, wehrte Arthur Hoffmann entschieden ab. „Nein, nein, da hat Evchen schon ganz Recht! Wenn Österreich wirklich weitreichende Forderungen an Belgrad stellen will, dann müssen handfeste Beweise her.“ Das genannten „Evchen“ schwankte zwischen Ärger über den öffentlich gebrauchten Kosenamen und Stolz über das unverhoffte Lob. „Aber wenn diese Beweise nicht allerhöchste serbische Repräsentanten wie Ministerpräsident Pasic oder König Peter persönlich belasten“, fuhr ihr Vater fort, „kann Wien nicht mehr tun, als polizeiliche Untersuchungen in Serbien zu fordern.“
„Und wenn die Serben sich dagegen zur Wehr setzen, und die Russen wieder mal ihre Partei ergreifen?“, mischte sich Theo ein.
„Wenn es wirklich Beweise gibt, dann werden die Serben nicht so dumm sein, sich zu weigern“, befand Arthur Hoffmann aber. „Denn, dass der Zar mit Leuten paktiert, die Fürstenmörder schützen, wäre nun wirklich mehr als unwahrscheinlich. Natürlich wird es Schreihälse geben, die wieder Blut und Krieg fordern. In Österreich, in Serbien, in Russland und auch hier bei uns. Aber Gott sei Dank, sind sie es nicht, die Politik machen, sonst hätten wir schon längst einen großen europäischen Kieg bekommen.“
„Es war ja in den letzten Jahren einige Male nahe dran“, bemerkte Paul düster.
„Aber da waren handfeste politische Interessen im Spiel, und die sehe ich diesmal nicht“, erwiderte der Verleger. „Kommt Kinder, lasst uns hier Schluss machen und bei Aschinger noch ein Bier trinken. Halt, ich muss meine Tochter heimbringen!“
„Aber um dir Bier zu holen, darf ich doch auch zu Aschinger“, protestierte Eva, die gerne die Diskussion noch fortgesetzt hätte. „Außerdem essen mittags viele Frauen dort.“
„Aber Abends am Biertresen haben sie nichts zu suchen“, wehrte Arthur Hoffmann ab. „Deine Mutter würde mich erschlagen, Mädel!“
„In Begleitung so vieler Männer würde doch niemand wagen, mich zu belästigen“, argumentierte Eva.
Doch ihr Vater schüttelte energisch den Kopf. „Kneipengespräche sind nun mal nichts für Frauenohren. Weder möchte ich, dass du dergleichen zu hören bekommst, noch will ich all den Männern bei Aschinger den Abend verderben, weil sie auf deine Anwesenheit Rücksicht nehmen müssen. Nein, wir beide gehen nach Hause!“
Dienstag der 30. Juni 1914
„Also diese Hetze ist doch wirklich infam. Und so dumm außerdem: Ein Widerspruch nach dem anderen!“ Arthur Hoffmann stellte vor lauter Erregung seine Tasse so hart ab, dass ihm der Kaffee über die Hand lief. „Die Deutsche Tageszeitung wieder einmal … Die werfen doch nur so mit Schmutz um sich .... Liebling, wo ist die Serviette? … Ach so ...“ Er zog die Serviette ruckartig unter der Zeitung hervor, wischte sich den Kaffee ab und knüllte dabei die DTZ zur Seite.
„Was soll dieser Dreck auf meinem Honigbrot?“, kreischte seine Tochter entsetzt.
Arthur Hoffmann zog das misshandelte Blatt wieder an sich. „Also wirklich! Hör dir das nur an, Magda! Auf Seite eins steht, es handele sich um sozialistische Verhetzung ...“
„Von was redest du, Liebling?“, unterbrach Magda Hoffmann mit der Gelassenheit eines Menschen, der solche Szenen Tag für Tag an seinem Frühstückstisch erlebt.
„Von dem Attentat auf den Erzherzog natürlich. Also auf Seite eins wird der Mord als sozialistische Verhetzung bezeichnet. Und auf Seite zwei hält man der Behauptung des serbischen Blattes Balcane, die Attentäter seien Sozialisten, entgegen, das sei nicht richtig. Laut eigenen Aussagen seien es serbische Nationalisten. Und dann hier, da kommt es noch dicker, da steht: Die Tatsache, dass der abgesetzte serbische Kronprinz Georg in seinem Londoner Exil Drohungen und Schmähungen gegenüber Franz Ferdinand geäußert habe, sei ein Beweis für die Schuld des offiziellen Serbiens. Das wäre ja irgendwo noch verständlich – dumm, aber verständlich –, wenn man annehmen könnte, die DTZ wisse einfach nicht, dass Georg in heftigster Opposition zu seinem Vater und der serbischen Regierung steht. Aber nein, im nächsten Artikel auf derselben Seite – Derselben Seite! Stell dir das einmal vor, Magda! – schreibt man, dass Prinz Georg und die Militärpartei die serbische Regierung und König Peter zu entmachten versuchen. Das ist doch einfach nicht zu fassen! Und sogar über das Tageblatt ziehen sie her. Gestern war ihnen das Bedauern der Sozialisten über die Tat nicht laut genug, und sie haben ihnen eine geistige Mittäterschaft in die Schuhe geschoben, heute sind die Liberalen an der Reihe. Das Tageblatt habe kein Bedauern gezeigt, wird behauptet es, und dabei zitieren sie über mehrere Zeilen genau dieses Bedauern. Das Attentat werde in den Dienst freisinniger Politik gestellt, heißt es weiter. Dabei sind sie es, die es in den Dienst widerlicher Polemik gegen alles stellen, was nicht in ihr borniertes, chauvinistisches Welthbild passt. Das ist doch wirklich zum Übelwerden.“ Erregt knüllte der Verleger das Blatt ein zweites Mal zusammen und stampfte es mit der Hand mehrmals auf den Tisch.
„Willst du die Erwiderung des Tageblattes hören?“, erkundigte sich seine Tochter.
Arthur Hoffmann hätte seine Lieblingszeitung lieber ganz für sich gehabt. „Lass mal sehen“, forderte er auf und streckte verlangend die Hand aus.
„Darf ich mit dir in die Reaktion?“, konterte seine Tochter.
„Was willst du denn den ganzen Tag dort? Du wärest nur im Weg und würdest dich langweilen“, wehrte er den Erpressungsversuch ab.
„Hat deine Wandervogelgruppe nicht Dienstags Nestabend?“, erinnerte Evas Mutter diplomatisch. Eva riss den Kopf hoch und starrte ihre Mutter einen Augenblick entsetzt an. Arthur Hoffmann Vater nutzte die Gelegenheit für den Raub des Tagblattes. „Wandervogel?“, erwiderte seine Tochter unterdessen. „Nein, wir haben auf Mittwoch verlegt. Oh Gott, aber etwas anderes hab ich ganz vergessen! Oh Himmel, da steht mir ja ... Mama, wie spät ist es?“
„Zwei Minuten nach neun.“
„Nach? Dann ist sie unpünktlich. Das kann nicht sein.“
„Was ist denn nur, Liebling?“, wollte Magda Hoffmann besorgt wissen.
In diesem Augenblick schellte es. Eva seufzte abgrundtief. „Das ist sie.“
„Wer?“
„Else Heinz. Ich habe zugesagt, sie beim Einkauf von Vorhangstoff zu begleiten. Sie will unser Gruppennest verschönern.“
„Das ist doch eine nette Beschäftigung.“ Arthur Hoffmanns Tonfall klang ganz arglos, aber sein Grinsen entbehrte nicht der Süffisanz.
Seine Tochter erhob sich mit gequältem Gesicht von ihrem Stuhl: „Du kennst Else nicht.“
Im nächsten Augenblick kam schon das Hausmädchen Lore herein. „Fräulein Eva, eine Freundin für sie!“
Else wartete im Salon. Trotz der Verspätung musste sie sich beeilt haben, denn ihr rundes Gesicht hatte fast die gleiche rosa Farbe wie ihre viel zu reichlich mit Rüschen und Spitzen dekorierte Bluse. Unter dem unmodisch breitkrempigen Hut, der einen halben Garten als Blumenschmuck trug, hingen ein paar Haarsträhnen unordentlich hervor. Sie blickte Eva reumütig an. „Ich hoffe, ich bin nicht zu spät.“
„Oh, nein, nein“, wehrte Eva ab. „Du könntest gar nicht zu spät kommen.“
„Meine Droschke wartet noch unten“, versicherte Else wie zur Entschuldigung.
„Ich dachte, wir fahren Straßenbahn“, tat Eva überrascht.
„Oh, die Straßenbahn“, stammelte Else verwirrt. „Nein, ich dachte ...Benutzt du sonst die Bahn?“
„Das tun wir doch alle“, versetzte Eva mit harmloser Miene. „Als wir neulich gemeinsam den Tiergarten besucht haben...“
„Aber da war doch die ganze Horde unterwegs“, rief ihre Wandervogelschwester aus. „Aber so allein! Nein, bitte lass uns die Droschke nehmen. Sie wartet ja jetzt auch schon.“
Eva brach ihr boshaftes Spiel gnädig ab, ließ sich aber Zeit, um ihren Hut, einen Sonnenschirm und einen Beutel für die Einkäufe zusammenzusuchen. Elschen saß derweil auf der äußersten Kante ihres Stuhls und zupfte nervös an ihren Handschuhen herum.
Das reizte Eva erneut. „Wie kannst du bei dieser Hitze nur Handschuhe tragen? Es muss doch entsetzlich sein! Heute Morgen um acht hat das Thermometer schon 17 Grad angezeigt.“
Sofort hörte Else schuldbewusst mit dem Zupfen auf. „Ich weiß nicht …“, begann sie.
„Wenn wir mit der Horde auf Fahrt sind, trägst du doch auch keine Handschuhe“, führte Eva genüsslich an. „Und überhaupt tun das inzwischen viele Damen nicht mehr. Man wird deswegen kaum noch schief angeschaut.“
Einen Augenblick sah Else aus, als wolle sie die beanstandeten Kleidungsstücke ablegen, dann begann sie aber wieder zu zupfen.
Eva ließ es für einen Moment damit bewenden, doch kaum dass sie in der Droschke saßen, fragte sie Else: „Weißt du, dass heute der Prozess gegen Rosa Luxemburg beginnt?“
„Neeein“, kam es gedehnt von Elschen. Sie fing schon wieder mit dem Zupfen an. „Wohin sollen wir fahren?“, versuchte sie das Thema zu wechseln.
„Du weißt doch, dass Rosa Luxemburg wegen Verunglimpfung der Armee angeklagt ist?“, beharrte Eva aber in freundlichstem Tonfall.
Else wurde immer nervöser. „Unser Mädchen hat gesagt, bei Israel hätten sie sehr schöne Druckstoffe im Ausverkauf.“
„Lass uns lieber in die Leipziger Straße fahren. Da sind Wertheim und Tietz. Da finden wir bestimmt etwas“ Eva graute davor, mit Elschen von einem Warenhaus ins andere zu ziehen. Sie hätte die Sache am liebsten fußläufig bei Jandorf in der Wilmersdorfer Straße erledigt. Aber Jandorf galt als Volkskaufhaus und war Elschen offenbar nicht gediegen genug. Das ebenfalls zum Jandorf-Konsortium KadeWe dagegen war natürlich zu teuer. Also wies Eva den Kutscher an, die prächtige Wertheim-Filiale am Leipziger Platz anzusteuern, die von vielen als schönster Konsumtempel Deutschlands gerühmt wurde. Nachdem sie das geklärt hatte, ging sie nahtlos wieder zu Rosa Luxemburg über: „Du siehst dem Ausgang des Prozesses bestimmt auch schon mit Spannung entgegen“, unterstellte sie dem armen Elschen. „Man sagt, es hätten sich bisher 922 Zeugen gemeldet, die für Rosa Luxemburg aussagen wollen. Du weißt ja, sie hat behauptet, in der Reichswehr würden Soldaten misshandelt. Und Kriegsminister Falkenhayn war so dumm, sie wegen Verleumdung und Verunglimpfung anzuklagen. Jetzt gehen, dem Vernehmen nach, mit jeder Post neue Meldungen ein, dass Soldaten über Mißhandlungen aussagen möchten. Ich denke, daß der Prozess ein Fiasko für die Armee wird. Du nicht auch?“
Elses hatte inzwischen einen nervös flackerenden Blick. „Bitte Eva“, wagte sie endlich zu stammeln. „Ich weiß nichts von diesem Prozess und auch nicht, wer diese Frau Luxemburg ist. Sei mir bitte nicht böse!“
„Ach nein, Elschen“, gab Eva heiter zurück und beschloss, es mit diesem Geständnis gut sein zu lassen. „An was für einen Stoff hast du denn gedacht? Einfarbig oder gemustert?“
Elschen lächelte sie dankbar an. „Ich dachte, ein Blumenmuster wäre am hübschesten“, begann sie eifrig zu erklären. „Es steht für die Schönheit der Natur und das passt doch vielleicht am Besten zu uns Wandervögeln.“
Wenn sie erst einmal ins Plaudern geriet, dann konnte Else Heinz so schnell nichts stoppen. Eva setzte dem auch nichts mehr entgegen, und liess die Vorzüge und Nachteile von Musselin und Batist geduldig über sich ergehen, hörte sich an, welche Stoffe Elschen in ihrem Leben schon wo eingekauft hatte, und was man beim Nähen von Vorhängen alles zu beachten hatte. Sie lotste die Freundin, die in dem Gedränge und Geschiebe bei Wertheim beträchtliche Anzeichen von Panik zu zeigen begann, in die Stoffabteilung, zeigte auch keinerlei Ungeduld, als sich Elschen jeden Vorhangstoff, den das bekanntermaßen gut sortierte Kaufhaus führte, mindestens fünfmal zeigen ließ. Zu einem gewissen Mitleid mit dem bereits arg getrietzten Elschen mischte sich vor allem die Erkenntnis, dass jeder Versuch die Prozedur abzukürzen, die Freundin verwirren und die Stoffauswahl noch schwieriger gestalten würde. Eva rang sich sogar ein paarmal durch, ein kurzes lobendes Wort über einen Stoff fallen zu lassen, der Elschen besonders zu begeistern schien. Endlich war die zu einer Entscheidung gekommen. Glückstrahlend verfolgte sie, wie das Paket zusammengepackt wurde und von einem Angestellten des Kaufhauses zur Droschke getragen.
„Was die anderen wohl sagen werden? Du meinst doch auch, Eva, dass der Stoff ihnen gefällt, nicht wahr?“
Eva sagte langmütig immer wieder „Jaja, bestimmt“ und Else hätte glücklich bleiben können, wenn sie nicht einen folgenschweren Fehler gemacht hätte.
Sie sagte: „Eigentlich müssen wir uns ja bei Moritz bedanken. Er hat angeregt, dass das Nest doch mit neuen Vorhängen noch viel gemütlicher aussehen würde.“
Eva blieb abrupt stehen: „Moritz?“, schrie sie ziemlich laut.
„Ja! War das nicht ein famoser Gedanke von ihm?“, strahlte Elschen. „Ich dachte immer, dass es die Burschen gar nicht interessiert, wie hübsch wir das Nest ausgestalten. Aber Moritz ist da anders.“
Natürlich konnte das arme Elschen nicht ahnen, was Eva im Moment vom schönen Moritz Odenwald hielt, denn das gehörte zu deren bestgehütetsten Geheimnissen. Selbst Lea kannte die ganzen Ausmaße dieser Abneigung nicht. Allein die Tatsache, dass Moritz neue Vorhänge wünschte, wäre für Eva Grund genug gewesen, Elschens Unternehmen zu sabotieren. Dass Else sie aber auch noch dazu gebracht hatte, bei der Erfüllung dieses Wunschs behilflich zu sein, war unverzeihlich. In Evas Gehirn überschlugen sich die Rachegedanken und noch bevor sie die Droschke erreicht hatten, kam ihr ein wahrhaft teuflischer Plan.
„Zum Kriminalgericht“, gab sie dem Droschkenkutscher Anweisung.
„Aber, aber, Eva“, stammelte Elschen verwirrt. „Was wollen wir am Gericht? Lass uns doch nach Hause fahren!“
Eva lächelte ihre Freundin besonders nett an. „Wir müssen leider noch in Erfahrung bringen, wie der Luxemburgprozess begonnen hat, Else. Das verstehst du doch? Mein Vater hat mich darum gebeten und ich konnte ihm den Gefallen nicht abschlagen.“
Elschen wurde blass: „Du willst zu dem Prozess gehen? In den Gerichtssaal?“
„Natürlich!“
„Aber darf man das denn?“
„Natürlich“, wiederholte Eva im Brustton der Überzeugung, obwohl sie keine Ahnung hatte, ob der Luxemburg-Prozess öffentlich war oder nicht.
„Aber dort hat sich doch bestimmt eine Menge Volk angesammelt“, gab Elschen verängstigt zu bedenken.
Eva schien sie nicht zu verstehen: „Natürlich wird es ein großes Interesse an dem Prozeß geben. Denk nur an die ganzen Soldaten und alle Mütter, deren Söhne solchen Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt sein könnten! Ich könnte mir gut vorstellen, daß es sogar zu Demonstrationen kommt.“
Elschen quietschte panisch auf: „Eva, nein, bitte nicht, lass uns bitte umkehren. Das ist doch viel zu gefährlich. Stell dir vor, jemand wirft mit Steinen nach uns. Bitte, Eva!“
„Tut mir leid“, entgegnete Eva ruhig, aber bestimmt. „Aber mein Vater wartet auf Nachrichten. Er hat mich um Hilfe gebeten und ich kann ihn nicht enttäuschen.“ Daraufhin wusste Elschen nichts mehr zu erwidern, sie begann nur unterdrückt, aber heftig zu schlucken.
‚Stell dir einfach vor, du erleidest all das für Moritz Odenwald’, dachte Eva gehässig. ‚Wenn er dir mit seinem einschmeichelndem Lächeln sagt ‚Else, das Nest ist ja ganz famos geworden!’ dann wirst du all deine Qualen vergessen haben.’
Vor dem Kriminalgericht herrschte mitnichten ein Menschenauflauf, von Demonstrationen gar nicht erst zu reden. Aber schon der lebhafte Verkehr auf der Straße und auf den Bürgersteigen veranlasste Else, angstvoll den Arm der Freundin zu greifen.
„Weiß du sicher, dass das nicht verboten ist?“, jammerte sie. „Bitte, Eva, bitte lass uns umkehren!“
„Es wird uns schon ein Gerichtsdiener stoppen, bevor wir in verbotene Bereiche vorstoßen“, versicherte Eva munter.
Die Erwähnung des Gerichtsdieners ließ Else vor Schreck quietschen. „Eva, bitte, bitte, nicht!“
„Willst du hier draußen auf mich warten?“
Doch die Vorstellung, alleine im Unbekannten zu bleiben, war für Else Heinz schlimmer als alles andere. Also ließ sie sich von Eva mitziehen.
Weit kamen sie nicht. Der Pförtner beschied Evas Frage, ob es möglich sei, Zugang zum Luxenprozess zu bekommen, mit dem simplen Bescheid: „Da hättense früher uffstehn müssn, Frollein!“
„Können Sie mir dann vielleicht wenigstens sagen, wie es drinnen steht?“
„Junge Dame, seh ick aus, als könnt ick durch Wände hörn? Aber wenn se sich lange jenug ihre hübschen Beene innen Bauch stehn, wird schon wer rauskommen, den se frajen können.“
Eva warf einen sehnsüchtigen Blick in das monumentale Treppenhaus, das sich hinter der Pförtnerloge auftat und überlegte, was sie tun sollte, als im Inneren tatsächlich zwei Herren auftauchten und Richtung Ausgang strebten.
„Entschuldigen Sie bitte die Störung!“, sprach Eva sie an. „Wissen Sie zufällig etwas Neues über den Luxemburgprozess?“
Einer sah sie indigniert, der andere lediglich überrascht an. „Der hat doch kaum angefangen! Aber seien Sie beruhigt, gnädiges Fräulein, diese Furie bekommt schon, was sie verdient. Um das deutsche Heer brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.“
„Nun, ich mache mir auch eher um meinen Verlobten Sorgen, der dort dient“, behauptete Eva kühn. „Man hört ja schließlich Furchtbares und alles kann wohl kaum aus der Luft gegriffen sein.“
Ihre wohlgesetzten Worte bewirkten eine jähe Verwandlung bei den beiden Herren. Der Indignierte wurde zornesrot und ballte die Hände, der andere spuckte fast, als er erwiderte: „Das wird ein schön jämmerlicher Kerl sein, wenn er zulässt, dass seine Braut auf der Straße rumläuft, anständige Bürger belästigt und diesen Politweibern nachbetet.“
Die Heftigkeit der Beschimpfung machte Eva für den Moment perplex. Sie überhörte Elschens entsetztes Flehen, dachte angestrengt nach und bemühte sich dann um ein süßes Lächeln: „Meine Herren, jeder unvoreingenommene Beobachter dieser Szene, würde Anstand und Höflichkeit nur auf meiner Seite feststellen können. Seien sie froh, dass mein Verlobter ihre Ungezogenheiten nicht mitgehört hat.“ Dann aber drehte sich auf dem Absatz um, bevor die beiden etwas erwidern konnten.
Doch ein scharfes „Genau“ stoppte ihren Abgang. Hinter den beiden tauchte Bruno Novis auf. „Meine Herren“, erklärte er in einem schneidenden Tonfall, der jedem Offizier Ehre gemacht hätte. „Ich muss sie auffordern, damit aufzuhören, die Dame zu belästigen …“
Die beiden musterten ihn. Bruno ging zwar an Krücken, aber er hatte Schultern und Oberarme wie ein Preisboxer. Er machte keinen schwächlichen Eindruck. Auch sein Blick war mehr als herausfordernd. Seine Gegner entschlossen sich zum Rückzug. „Unverschämtheit so was“, murmelte der eine noch. „Muss man sich nicht bieten lassen …“ Aber sein Kamerad zog ihn weg.
Eva grinste breit. „Was machen Sie hier?“, erkundigte sie sich. „Den Prozessbericht?“
„Jede Art von Theater ist meine Spezialität.“
„Und was ist bisher passiert?“, wollte sie begierig wissen.
Bruno zuckte mit den Achseln. „Noch nicht viel!“ Dann begann er zu lachen. „Schauen Sie mich nicht an, als wollten sie mir gleich meine Notizen entreissen. Ich erzähle ja schon. Bisher wurde die Anklageschrift vorgelesen und damit auch all die Schikanen, die die Luxemburg der Armee vorgeworfen hat: Die Soldaten mussten mit der Zahnbürste ihre Stube fegen, sich bei 22 Grad Kälte ausziehen, in eine Wanne steigen und mit Bürsten bis aufs Blut traktieren lassen, sich wegen ihrer Herkunft beschimpfen lassen – vor allen die Elsässer und Lothringer –, sich mit Stecknadeln blutig stechen lassen, mit gefesselten Händen und einem Gewehr, das sie bei jedem Schritt in die Knie bohrte, exerzieren, sich ins Gesicht schlagen lassen, wieder bis aufs Blut...“
„Oh, Himmel“, rief Eva entsetzt aus. „Und Sie haben Gott gedankt, dass Sie da nie hin mussten, als sie das hörten?“
Bruno grinste: „Es gibt gelegentlich Momente, in denen ich mir denke, dass zwei lahme Beine nicht das schlimmste aller Schicksale sind. Stellen Sie sich vor, wie genüsslich ich mich erst zurücklehnen werde, wenn wirklich einmal ein Krieg ausbricht.“
„Ich frage mich nur, wer davon berichtet“, kam Eva wieder auf den Prozes zu sprechen.
„Nun, wir zum Beispiel“, erwiderte ihr Gegenüber. „Und ich würde mich nicht wundern, wenn es auch in der Kreuzzeitung steht.“
„In der Kreuzzeitung? Nie im Leben“, rief Eva überzeugt.
„Die Kreuzzeitung ist das Blatt der Militärs“, führte Bruno an, „und die möchten doch wissen, um was es geht. Dazu gehören nun einmal die Anschuldigungen. Wetten wir?“
„Gut“, erwiderte Eva sofort. „Ich halte dagegen! Das steht nie und nimmer ausführlich in der Kreuzzeitung. Um was soll es gehen?“
„Um was kann man mit einer Dame mit Anstand wetten?“, erkundigte sich Bruno feixend.
Eva hob die Schultern. „Keine Ahnung! Was Fragen des Anstandes angeht, bin ich keine Expertin. Was meinst du, Elschen? Um was kann man wetten?“
„Ich weiß nicht“, bibberte Elschen völlig verwirrt. „Ich habe einmal einen Roman gelesen, da ging es um einen Kuss.“
Sie erntete brüllendes Gelächter von beiden Parteien.
„Ich halte einen anständigen Kuss für einen etwas kargen Wetteinsatz“, entschied Bruno schließlich. „Und für einen unanständigen ist mir meine Stellung bei Ihrem Vater zu lieb. Passen sie auf, Fräulein Hoffmann! Sollten sie gewinnen, verpflichte ich mich, in meine Berichterstattung eine kleine Episode einzubauen, wie eine hübsche, junge Dame, die sich rührend um ihren diensttuenden Verlobten sorgt, von zwei unverbesserlichen Militärs aufs Unflätigste beschimpft wird.“
„Das ist wunderbar“, rief Eva begeistert. „Da fällt es mir wirklich schwer, etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen.“
„Nun, ich hätte da einen Vorschlag“, meinte Bruno ruhig. Eva sah ihn zweifelnd an. Sie hatte den dringenden Verdacht, dass seine Gedanken umso tückischer waren, je harmloser sein Gesicht wirkte. „Wenn Sie verlieren, dann trällern Sie doch bitte in Anwesenheit der Herren Hoffmann, Johannsen und Zimmermann die Internationale vor sich hin.“
„Alle drei Strophen?“, rief Eva entsetzt aus.
„Nun ja, wenn Sie eindeutig dazu aufgefordert werden, dürfen sie vorher Schluss machen.“
„Und das nennen sie anständig?“, stöhnte Eva. „Auf deutsch oder russisch?“
„Wenn Sie es können, dürfen Sie auch gerne auf Russisch singen.“
„Ich werde es lernen“, versprach Eva mit nochmaligem abgrundtiefem Stöhnen. „Aber gut, ich nehme an. Wird der Prozess heute eigentlich noch weitergehen?“
„Schon, aber Neuigkeiten wird es kaum noch geben. Ich bin auf dem Weg zur Redaktion.“
„Soll ich Ihnen behilflich sein?“
Brunos Gesicht verzog sich spöttisch: „Wenn sie einen Vorwand brauchen, dort aufzutauchen, dürfen Sie das gerne tun.“
Hochbefriedigt wandte Eva sich an ihre Freundin: „Tut mir leid, Elschen, ich fürchte, du wirst ohne mich heimfahren müssen.“
„Du kannst mich doch nicht allein lassen?“, stammelte die.
„Aber, Elschen“, erwiderte Eva mit verständnisheischendem Lächeln. „Ich kann Herrn Novis doch nicht meine Hilfe verweigern. Das wirst du doch einsehen.“ Ihr Opfer starrte in verlegener Panik auf Brunos Beinschienen.
Der spielte das Spiel mit: „Es wäre mir wirklich eine außerordentliche Erleichterung, wenn Ihre Freundin mich begleiten könnte“, log er schamlos. „Wissen Sie, die Stufen der Straßenbahn! Das ist gefährlich für jemanden wie mich! Vor allem beim Aussteigen!“
Elschens geplanter Protest erstarb über dieser Feststellung. Ihre Panik blieb. Eva beeilte sich, Bruno mit sich wegzuzerren. Sobald sie jedoch aus Elschens Sichtweite waren, machte er sich frei. Bruno pflegte beide Krücken gleichzeitig nach vorne zu setzen und dann die Beine nachzuschwingen. Auf diese Weise kam er so schnell vorwärts, dass manch einer Mühe hatte, mitzuhalten. Seine imponierenden Schultern kamen nicht von ungefähr. Beim Ein- und Aussteigen in die Straßenbahn gab er Eva dann zwar seine Krücken zum Halten, das aber mit derart provokantem Grinsen, dass ihr klar war, dass solcher Dienst völlig überflüssig war.
Auch Arthur Hoffmann runzelte misstrauisch die Stirne, als seine Tochter auftauchte und ihm lammfromm berichtete, wie sie zufällig dem armen Bruno begegnet sei und ihm natürlich behilflich gewesen wäre. „Könnte es sein, dass deine Mutter dich in wenigen Minuten zum Essen erwartet?“
Eva warf einen schnellen Blick auf die Redaktionsuhr. „Das ist in der Tat möglich. Ich werde mich beeilen. Gibt es hier etwas Neues?“
„In Albanien ist Prenk Bibdoda verschwunden, aber das dürfte dich kaum interessieren. Hopp, mach dass du raus kommst!“
„Und vom Attentat?“
„Krawalle auf dem Balkan. In Mostar sollen 200 Serben erschlagen worden sein und die Stadt steht angeblich in Flammen. Belgrad soll aber erklärt haben, es wolle gegen anarchistische Bestrebungen vorgehen, und Wien will Serbien dem Vernehmen nach ganz friedlich und diplomatisch um Hilfe bei der Untersuchug des Attentats bitten, so dass selbst die Kreuzzeitung meint, dass kein konfrontativer Schritt nötig sei. Aber wenn du deine Mutter warten lässt ...“
„Ich bin ja schon weg ...“, versicherte Eva.
Magda Hoffmann überlegte in der Tat gerade, ob sie endlich auftragen lassen sollte, da Alfie immer quengeliger wurde, als sie das Schlagen der Haustüre hörte und ihre Tochter die Treppe heraufgestürmt kam.
„Tu mir leid“, rief die aus dem Flur, wo sie sich den Hut vom Kopf riss und die Straßenschuhe von den Füßen zerrte. „Aber du hast keine Ahnung wie enervierend Elschen sein kann. Sie kann sich einfach nicht entscheiden. Und ich konnte sie ja schließlich nicht einfach stehen lassen.“
„Ja, natürlich nicht“, stimmte ihre Mutter zu. „Ich habe ja auch gar nichts gesagt, Liebling.“ Da sie Elschens Eltern nicht kannte, bestand kaum die Gefahr, dass sie jemals erfahren würde, was wirklich passiert war.
Während Magda Hoffmann in die Küche ging, um dem Mächen Bescheid zu sagen, dass serviert werden konnte, ließ sich Eva am Tisch nieder und griff zu den Zeitungen, die sie beim Frühstück noch nicht hatte durchgesehen hatte. Ihre Mutter verzog das Gesicht als sie wieder hereinkam und ihre Tochter hinter den Seiten des Berliner Lokalanzeigers verborgen sah. Auch ihr Mann pflegte seine Zeitungen erst in dem Moment wegzulegen pflegte, in dem alle Schüsseln auf dem Tisch standen.
Der Lokalanzeiger war für seine politische Belanglosigkeit bekannt. Dafür verwöhnte sie ihre Leser mit pikanten Geschichten, die ihm auch den Beinamen „Skandalanzeiger“ eingebracht hatten, dem Abdruck vieler Photographien und einem großen, bunten Anzeigenteil. „Es gibt wirklich hübsche Dinge, wenn man Geld hat“, verriet Eva ihrer Mutter. „Wie findest du das? Weltreise mit dem Schiff: Hamburg, New York, Niagarafälle, Washington, Philadelphia, Havanna, Kingston, Colon, Panamakanal, San Francisco, Hilo, Honolulu, Yokahama, Kobe, Nagasaki, Tsingtau, Hongkong, Manila, Batavia, Singapore, Rangoon, Colombo, Bombay, Suez, Port Said, Neapel, Gibraltar, Southhampton, 141 Tage. Klingt traumhaft, nicht wahr? Und kostet auch bloß 3825 Mark.“
„Aber trotzdem ein wenig über dem, was wir für dein nächstes Geburtstagsgeschenk anzulegen gedachten“, erwiderte ihre Mutter mit sanfter Ironie. „Könntest du jetzt bitte...“
„In der Kreuzzeitung war auch was Nettes, aber vermutlich noch teurer“, plauderte Eva ungerührt weiter und suchte sich das Blatt aus dem Stapel. „Hier ist es: Schloss nahe Berlin, 25 Wohnzimmer und Säle, mit jeglichem Komfort, in großem, altem Park am See, Wintergarten, Stallungen, Remisen, Autogarage, Kutscher-Diener-Gärtner-Wohnung, großer Obst- und Gemüsegarten, Palmen- und Treibhäuser, Tennisplätze, Schwimmbad, Bootshaus, nebst vorzüglicher Jagd auf circa 20000 Morgen, großes Revier, Fischerei, auf 3-5 Jahre zu vermieten.“
„Eva, leg bitte die Zeitung weg. Lore kommt gleich mit dem Essen“, versuchte es ihre Mutter.
Da das Hausmädchen wirklich gerade mit der dampfenden Suppenschüssel unter der Tür des Speisezimmers erschien, gehorchte Eva. „Mit dem Adel in unserem Land geht es wirklich bergab“, meinte sie aber. „Jeden Tag sind 40 oder 50 Herrensitze und Rittergüter allein in der Kreuzzeitung und DTZ inseriert. Ich begreife gar nicht, dass es noch Junker gibt. Wenn es so weiter geht, wird aus Deutschland vielleicht doch einmal eine Republik. Andererseits treten an ihre Stelle all diese neureichen Industriekapitäne, die nach Kolonien und Absatzmärkten schreien. Mitunter denke ich, die sind noch gefährlicher als ein paar zurückgebliebene Landjunker, die lediglich ihr Personal schikanieren und Schutzzölle für ihr Getreide fordern.“
„Eva, wir wollen beten! Die Suppe wird kalt“, unterbrach ihre Mutter.
Die wirklich interessanten politischen Nachrichten standen natürlich erst in den Abendblättern, die Arthur Hoffmann mit aus der Redaktion zu bringen pflegte. Allerdings hortete er seinen Schatz stets eifersüchtig.
„Hättest du vielleicht auch für mich ein Stück Zeitung?“, versuchte es seine Tochter im artigsten Ton.
Sie erwartete Ausflüchte. Doch ihr Vater grinste: „Ein Stück Zeitung? Ja, richtig, natürlich, da habe ich doch extra etwas aus der DTZ ausgeschnitten. Wo ist es denn?“ Er begann in den Taschen seiner Jacke zu suchen und fand schließlich einen gefalteten Ausschnitt. „Hier, für dich, Töchterchen!“
Eva lies ihn mit einem Blick wissen, dass sie auf jede Bosheit gefaßt war, begann aber zu lesen. „Selbstlose Frauen: Etwas unendlich Rührendes liegt in der Eigentümlichkeit der Frauen, ihr eigenes Wohl und Wehe, ihr Wünschen und Verlangen in den Hintergrund, die Interessen der Ihrigen dagegen stets voranzustellen. In dieser echt weiblichen Tugend spricht sich ein Heldentum ohnegleichen aus, und manchen von uns werden schon oft genug wahren Märtyrerinnen an Selbstlosigkeit und Aufopferung begegnet sein. Es liegt in der Natur der Frauen, an sich selbst stets zuletzt zu denken, ja namentlich die deutschen Freuen sind aus diesem Grade berühmt geworden. Sie wurden von den Dichtern aller Zeiten...“ Der lauernde Blick ihres Vaters ließ sie abbrechen. „Sehr schön“, meinte sie. „Aber was willst du eigentlich damit sagen? Wenn du wissen möchtest, ob auch ich der Meinung bin, dass diese lobenden Zeilen direkt auf meine Mutter gemünzt sein könnten, dann kann ich dir nur zustimmen.“
Arthur Hoffmann grinste: „Touché! Du wirst mir langsam zu gerissen, Kleine!“
„Hättest du lieber eine dumme Tochter?“, konterte Eva.
Ihr Vater grinste noch mal, dann widmete er sich wieder seiner Zeitung. Doch Eva hatte keine Lust, sich abwimmeln zu lassen. „Warum liest du eigentlich immer diese DTZ? Das ist doch nun wirklich das übelste Hetzblatt von allen. Ich finde, das D im Namen müsste für Dreck stehen, nicht für Deutsch.“
„Man muss doch informiert sein, was der Feind so schreit. Immerhin steht hinter der DTZ der Bund der Landwirte, und der ist wieder ein Hilfsverband der deutsch-konservativen Partei. Die mag zwar nur noch 9 Prozent der Stimmen haben, aber die wichtigen Ressorts in Politik, Verwaltung und Diplomatie sind immer noch mit konservativen Vertrauensleuten besetzt. Das sind nicht nur ein paar unbedeutende Dummköpfe, die diesen Dreck schreiben und lesen.“
„Ich dachte, das Leib- und Magenblatt der Konservativen ist die Kreuzzeitung. Aber die finde ich gegen die DTZ geradezu moderat. Mir klingt das, was in der DTZ steht, sehr nach diesem grässlichen Alldeutschen Verband.“
„Naja, das überschneidet sich“, gab ihr Vater zu. „Zu den Geldgebern der Alldeutschen gehören sowohl Großgrundbesitzer, die deutsch-konservativ wählen, als auch eine ganze Reihe von neureichen Schwerindustriellen, die es politisch mehr mit den Freikonservativen und Nationalliberalen halten. Du solltest einmal einen Blick in die Leipziger Neuesten Nachrichten werfen. Die schlagen sogar noch die DTZ, was Schund und Schmutz betrifft. Sind aber die meistgelesenste deutsche Zeitung außerhalb Berlins. Fast 150.000 Stück Auflage. Paul hat heute Morgen eine Ausgabe besorgt. Wird immer ganz fuchtig, der arme Junge, wenn er das liest. Es war aber auch zu schlimm. Nach dem Attentat stelle sich für Deutschland die Frage, hieß es da, ob die Deiche gegen die slawische Flut noch hielten, da mit Franz Ferdinand der Deichhauptmann gefallen sei.“
„Klingt, als müsse man sich gegen irgendwelchen Unrat verteidigen“, fand Eva.
Ihr Vater schnaubte böse: „So sehen die Brüder das auch. Alles Untermenschen für sie, was nicht zu ihrem Klüngel gehört. Seien es Liberale, Sozialdemokraten, anständige Konservative, Juden, Franzosen, Engländer, Slawen, egal. Geschichte und Politik sind ein einziges Durchsetzen von eigenen Egoismen für sie, ohne Rücksicht auf irgendjemand anderen. Und dabei führen sie noch die haarsträubensten moralischen Rechtfertigungen für ihr Tun an. Es ist wirklich widerlich. Oder hier …“ Arthur Hoffmann schlug wütend auf die aufgeschlagene Seite der DTZ. „Graf Reventlow, einer der schlimmsten Hetzer, schreibt, Österreich solle mit seinen Anklagen gegen Serbien nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil sich da andere einmischen könnten. Stattdessen soll es lieber selbstständig und energisch vorgehen, gestützt auf die „erhaltenden Elemente“, besonders das Militär. Und die schlimmen antiserbischen Kundgebungen in Bosnien und Kroatien werden als gutes Omen gedeutet, dass die Bevölkerung in den Balkanprovinzen solche Militäraktionen unterstützten würde.“
„Aber sie meinen schon nur ein energisches, militärisches Vorgehen in Bosnien, nicht gegen Serbien, oder?“, erkundigte sich Eva.
„Wer weiß! Einem Hetzer wie Reventlow würde ich auch letzteres zutrauen.“
„Aber das würde ja doch Krieg bedeuten! Gestern hast du doch gesagt …“
„Nun bekomm mal keine Panik, Mädchen!“, wiegelte Arthur Hoffman ab. „Reventlov und die DTZ sind nicht die Regierung. Auch, wenn unser Kaiser manchmal ähnlich klingt. Aber inzwischen weiß doch jeder, dass Willem Zwo gerne mit dem Säbel rasselt, aber einer der ersten ist, der bereit ist, einzulenken, wenn es wirklich brenzlig wird. Und dieses ganze Attentat ist eine innerösterreichische Angelegenheit. Dabei bleibe ich. Da macht mir Albanien mehr Sorgen. Da wird inzwischen ganz offen über einen Einmarsch spekuliert.“
„Was ist da los?“, wollte Eva wissen. „Ich versteh das nicht.“
Wenn es irgendetwas gab, was Arthur Hoffmann unfehlbar von seinen geliebten Zeitungen abbringen konnte, dann war es die Gelegenheit einen politischen Vortrag halten zu dürfen. Beinahe strahlend faltete er das Blatt zusammen und begann eine kleine Unterrichtseinheit in Sachen Albanien für seine Tochter:
„Nun, du wirst dich erinnern, Eva, dass der Staat Albanien erst im vergangenen Jahr auf der Botschafterkonferenz in London von den Großmächten geschaffen worden ist!“
„Das weiß ich“, warf Eva ein. „Ihr habt ja gestern erst in der Redaktion davon gesprochen. Die Balkanstaaten haben den Krieg gegen die Türkei gewonnen und wollten die Beute unter sich aufteilen.“
„Genau! Das Gebiet Albaniens wollten sich Serbien und Griechenland teilen. Das aber hätte bedeutet, dass Serbien sein Gebiet bis zur Adria ausgedehnt hätte. Österreich drohte, dies notfalls militärisch zu verhindern.“
„Und dann hat sich natürlich Russland auf die Seite Serbiens geschlagen und Deutschland auf die Österreichs und Frankreich auf die der Russen und England auf die der Franzosen …“, rekapitulierte Eva.
„Und alle sahen den großen Krieg schon vor der Türe stehen“, pflichtete ihr Vater bei. „Österreich und Russland hatten sogar schon mobil gemacht, wenn du dich erinnerst.“
„Was für ein Recht hat Österreich eigentlich, derartige Forderungen zu stellen?“, hakte Eva nach.
„Ach, Evchen“, gab ihr Vater zurück. „Recht in der Politik ist eine Sache. Macht eine andere. Das ganze Problem nahm seinen Anfang, als Russland die Serben 1876 in ihrem Freiheitskampf gegen die Türkei unterstützte. Nach dem russisch-serbischen Sieg stand zu befürchten, dass nun der ganze, bis dato osmanische Balkan russisch dominiert werden würde. Eine solche Verschiebung der Macht, ausgerechnet zu Gunsten des rückständigen und reaktionären Zarenreiches, wollten auch ganze andere vermeiden. Deutschland etwa. Oder Großbritannien. Also einigte man sich 1878 auf dem Berliner Kongress, dass – als Ausgleich für den russischen Einfluss in Serbien und Bulgarien – Österreich Bosnien und die Herzegowina besetzen durfte. Das hat natürlich den Serben gar nicht gefallen, die beide Provinzen als serbisches Territorium für sich beanspruchen.“
„Haben Sie ein Recht dazu?“
„Was heißt Recht? Natürlich sind Serben, Kroaten, serbische Kroaten, bosnische Serben, bosnische Muslime und Kroaten und so weiter stammesverwandt, mehr durch die jeweilige Religion getrennt, als durch Blut und Sprache. So etwas erweckt natürlich Begehrlichkeiten. Andererseits können stammesverwandte Völker auch in verschiedenen Staaten leben wie Deutsche und Österreicher beweisen oder auch Holländer und Belgier.“
„Wenn ich recht informiert bin, dann will die Mehrheit der Bevölkerung in den österreichischen Balkanprovinzen keineswegs den Anschluss an Serbien.“
„Das ist vollkommen richtig. Allerdings weigern sich die Großserben dies zu glauben.“
„Also müsste man eine Abstimmung vornehmen lassen.“
Arthur Hoffmann brach in Gelächter aus. „Nee, Evchen, das ist nun wirklich blauäugig. Stell dir vor, es würden dann entsprechende Forderungen in anderen Regionen laut. In anderen Provinzen Österreichs etwa oder in Elsaß-Lothringen und unseren Ostgebieten. So etwas könnte die ganze Weltkarte durcheinander wirbeln und die schönsten Turbulenzen hervorrufen, gegen die alle jetzigen Wirren ein Sturm im Wasserglas sind.“
„Aber um Albanien gibt es doch auch ständig Probleme, oder?“, warf Eva ein.
Ihr Vater seufzte. „Leider! Es ist ja nun nicht so, dass es klare Grenzen gibt, wo auf der einen Seite nur Albaner leben und auf der anderen nur Serben oder Griechen. Es kam also zu Grenzstreitigkeiten und vor allem als Serbien und Montenegro Skutari besetzt haben, sind die Wogen hochgeschlagen. Österreich wäre am liebsten einmarschiert und wenn dann nicht Russland Serbien beigesprungen wäre, dann hättest du mich Rumpelstilzchen nennen dürfen. Aber zum Glück hat unsere Regierung in Wien unmissverständlich klar gemacht, dass der Bündnisfall für sie nicht gegeben sei. Du siehst also, dass unsere Politiker wirklich keine Lust haben, sich wegen der österreichischen Balkanhändel in einen Krieg ziehen zu lassen.“
„Aber was ist jetzt in Albanien im Gange?“, bohrte Eva nach.
„Nun, um Albanien zu einem neutralen Staat zu machen, haben die Großmächte einen Fürsten eingesetzt, der in keiner Weise in irgendwelche Konflikte auf dem Balkan involviert ist: den deutschen Prinzen Wilhelm zu Wied. Außerdem wurde ihm eine starke niederländische Polizeitruppe zur Seite gestellt.“
„Aber was wissen die schon von Albanien?“, warf Eva ein.
„Das ist natürlich ein Problem“, gab ihr Vater zu. „Aber alle, die sich mit Albanien auskennen, sind in irgendeiner Weise Partei. Das gilt vor allem für eine Reihe albanischer Führer aus adeligen Familien, die als Offiziere in türkischen Diensten gestanden haben. Einer von ihnen, ein gewisser Essad Pascha Toptani, regierte über einen großen Teil Zentralalbaniens wie ein Fürst, hatte eine Privatarmee und finanzierte sie mit Steuern, die er ohne Legitimation kassierte. Er ging zum Schein auf die Politik der Großmächte ein und ließ sich vom Prinzen Wied zum Minister machen. In Wahrheit aber baute er seine Macht weiter aus. Er konnte im Mai gestürzt werden, aber leider hat das die Lage nicht beruhigt. Seitdem brachen ungezählte regionale Rebellionen aus. Außerdem halten die Griechen den Süden Albaniens besetzt und weigern sich mit der Begründung abzuziehen, der Schutz der griechischen Minderheit dort sei nicht garantiert. Unter diesem Vorwand aber unterstützen sie die schlimmsten Rebellen und Räuberbanden, die für Chaos und Gewalt in der Region sorgen. Auch Italien steht in dringendem Verdacht, albanische Rebellen zu unterstützen, um mehr Einfluss im Land zu bekommen.“
„Ich weiß ja nicht, ob das mit dem Prinzen Wied eine gute Idee war“, meinte Eva. „Aber wenn die Großmächte ihn eingesetzt haben, müssten sie ihm doch eigentlich auch beistehen?“
Ihr Vater seufzte wieder: „Das wäre möglicherweise das Allerschlimmste. Denn jedes Eingreifen einer ausländischen Macht, sei es eine der Großmächte oder ein Nachbarvolk, würde unweigerlich die Einmischung anderer nach sich ziehen, die ihre Interessen gefährdet sehen. Der Balkan ist ein Pulverfass, sagt man ja immer, und das ist leider nur zu wahr. Wenn erst einmal Österreich und Russland alarmiert sind, stehen wir möglicherweise vor der nächsten Krise, aus der ein europäischer Krieg werden kann. Und nun ist auch noch Prenk Bibdoda verschwunden, der mächtigste albanische Verbündete, den Prinz Wied hatte. Man weiß noch nicht, was dahinter steckt. Aber das könnte die ganze Krise verschärfen.“
„Das ist völlig verrückt“, meinte Eva schaudernd. „Wenn ich mir vorstelle, dass es in Deutschland Krieg geben könnte, nur weil ein albanischer Häuptling von der Bildfläche verschwunden ist! Ich finde das unheimlich, muss ich sagen. Wie konnte es soweit kommen?“
„Ach Evchen“, erwiderte ihr Vater. „Das ist eine lange und äußerst verwickelte Geschichte. Aber im Kern ist es so: Sowenig ich Bismarck innenpolitisch geschätzt habe, so muss man doch anerkennen, dass er in allen äußeren Belangen ein Virtuose war. Solange er die Zügel in der Hand hatte, lagen die Dinge im Lot. Allerdings war dieses Spiel so verwickelt, dass nur Bismarck es spielen konnte. Schon ein normaler vernünftiger Mensch wäre vermutlich überfordert gewesen, aber leider hat seitdem Wilhelm der Ungeschickte die Fäden der Politik in die Hand genommen, der nicht nur selber keinen Fettnapf auslässt, sondern auch noch dazu tendiert, lauter Stümper auf wichtige Posten zu berufen.“
„Was hätte Bismarck auf dieser Londoner Botschafterkonferenz besser gemacht?“
„Vielleicht gar nichts. Die Londoner Botschafterkonferenz war keine schlechte Sache, obwohl es natürlich kritisch zu sehen ist, dass die Großmächte weiter über die Köpfe der Kleinen hinweg entscheiden. Aber unter Bismarck hatten wir ein gutes Verhältnis zu Russland und auch kein schlechtes zu England. Das einzige Land, mit dem wir wirklich über Kreuz lagen, war Frankreich, das uns wegen unseres Sieges 1871 grollte. Auf dieser Basis ließen sich die Probleme auf dem Balkan regeln. Inzwischen haben unser Kaiser und seine Stümper Russland und England verprellt und zwar so gründlich, dass diese sich mit Frankreich verbündet haben, was keiner dieser Schwachköpfe für denkbar gehalten hat, und das einzige Land, das noch fest auf unserer Seite steht, ist Österreich-Ungarn. Das ist das Problem.“
Mittwoch, der 1. Juli 1914
Arthur Hoffmann schien nicht aufzufallen, dass seine Tochter ihn am nächsten Morgen am Frühstückstisch belauerte. Erst, wenn er nach einem weiterem Brötchen gegriffen hatte, langte auch sie zu, war damit aber immer viel früher fertig als er. Doch dann lenkte ihr kleiner Bruder sie ab. Alfie begann plötzlich so schnell am letzten Bissen seines Splitterhörnchens zu kauen, dass Eva sich sofort nach einem Grund umsah. Auf den zweiten Blick stellte sie fest, dass in dem Glas mit der stets heiß umkämpften Dattel-Yoghurt-Marmelade nur noch ein kleiner Rest war. Schnell griff sie nach dem Brötchenkorb und zog mit dem zweiten Griff auch gleich noch das Marmeladenglas an sich. Klein-Alfred verschluckte sich vor Zorn an seinem Hörnchen und sein Protestgeschrei ging in heftigem Husten unter. Arthur Hoffmann beugte sich zu seinem Sohn, klopfte ihm auf dem Rücken, meinte „Wird schon wieder, junger Mann!“, faltete seine Serviette und stand auf.
Eva erstarrte mit dem gerade geschmierten Brötchen in der Hand. Von draußen war bereits zu hören, wie ihr Vater zum Mantel griff. „Für dich“, sagte sie geistesgegenwärtig und schob dem verdutzten Alfie die Schrippe zu. „Lass es dir schmecken. Ich geh mit Papa.“ Und bevor ihr beglückter Bruder oder ihre Mutter etwas erwidern konnten, war auch sie im Flur. Ihr Vater merkte erst, was gespielt wurde, als seine Tochter hinter ihm durch die Wohnungstür schlüpfte und in unverfänglichem Plauderton meinte: „Zur Zeit wartet man wirklich jeden Morgen mit Spannung, was der Tag an Nachrichten bringt.“
Arthur Hoffmann schien einen Protest zu erwägen, dann seuzfte er nur tief: „Seit wann interessierst du dich so für Politik, Mädchen?“
„Oh, das tat ich schon immer. Du kannst nicht behaupten, dass ich nicht weiß, was in der Welt los ist! Glaubst du, jemand wie Else oder Lotti hätte deinem Vortrag gestern folgen können? Die wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass es ein Land namens Albanien gibt.“
Ihr Vater seufzte noch einmal: „Aber so glühend wie im Moment schien mir dein Interesse bisher noch nie. Was steckt dahinter?“
„Hör mal“, empörte sich Eva. „Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die albanischen Wirren möglicherweise geeignet sind, einen großen Krieg hervorzurufen, und dann erwarten, dass mich nichts mehr interessiert, als wie weit Elschen mit ihren Vorhängen ist?“
Arthur Hoffmann schien einzusehen, dass er einen Fehler gemacht hatte. „Ich habe nicht gesagt, dass ein Krieg vor der Tür steht“, korrigierte er. „Ich habe lediglich anklingen lassen, dass die Ereignisse möglicherweise eine gewisse Gefahr in diese Richtung in sich bergen. Aber ich habe volles Vertrauen in unsere Regierung, dass sie alles Erdenkliche tun wird, damit es nicht so weit kommt.“
Eva verkniff sich die Erwiderung, dass die SPD – Rosas Partei! – dieses Vertrauen keineswegs hatte.
Draußen auf der Straße war es bereits sehr warm. Arthur Hoffmann sah mit bedenklichem Blick zum wolkenlosen blauen Himmel: „Das sind bestimmt schon wieder über 20 Grad. Wenn wir Glück haben, kriegen wir wenigstens nachmittags ein Gewitter.“ Er warf einen neidischen Blick auf das leichte Sommerkleid seiner Tochter. „Hast du’s gut, Mädchen. In den Fähnchen lässt es sich bei dem Wetter aushalten.“
„Nun, es gibt einige wenige Momente im Leben, wo man es als Frau mittlerweile besser hat“, gab Eva zu. „Ich glaube, ich bin den Frauen, die das Korsett außer Mode brachten, mindestens so dankbar wie ich jenen sein werde, die einmal unser Wahlrecht durchsetzen.“
„Was du wählen würdest, möchte ich mir lieber nicht vorstellen“, erwiderte ihr Vater.
„Es wäre ganz bestimmt nicht rechts der Fortschrittlichen Volkspartei“, wurde er liebenswürdig beruhigt.
Arthur Hoffmann entschloss sich, keine näheren Erkundungen über die potentiellen Wahlabsichten seiner Tochter einzuholen, sondern meinte: „Komm, Mädchen, sehn wir zu, dass wir die nächste Bahn kriegen und in die Redaktion kommen. Dort stört es keinen, wenn man in Hemdsärmeln rumläuft.“
Doch in der Redaktion des Stadtanzeigers ging es lockerer zu, als seinem Besitzer lieb war. Als er die Türe zu den Büroräumen öffnete, hörte er als erstes Theos schrilles Lachen: „Wisst ihr, wie die Weiber es schaffen, größere Brüste zu kriegen? Mit Pillen! Steht hier: ‚Pilule orientalis. Entwicklung, Festigkeit und Neubildung. Seit Generationen verdanken unzählige junge Mädchen und Frauen diesen Pillen den verführerischen Reiz, den eine schöne Büste stets verleiht.’ Ob es so etwas auch für Männer gibt? Damit der Schwanz wächst?“
„Theo“, schrie Arthur Hoffmann in für ihn ganz ungewohnter Lautstärke in den Raum. „Behalten Sie Ihre Zoten gefälligst für sich, vor allem wenn Damen anwesen sind.“
Theos Lachen erstarb jäh, als er seinen Chef und dessen Tochter erblickte. Sein Gesicht färbte sich tomatenrot und er stammelte: „Tschuldigung, Herr Hoffmann. Tut mir wirklich leid! Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Damen anwesend sein würden. Und die Anzeige steht im Tageblatt, ehrlich wahr.“
Mit einem verärgertem Wink brachte der Verleger den jungen Reporter zum Schweigen. „Was gibt es Neues?“
Paul Zimmermann trat eifrig vor. Auch er wirkte peinlich berührt.
‚Wahrscheinlich überlegt er, was Papa von ihm denkt, weil er Theo nicht selber zur Ordnung gerufen hat’, dachte Eva boshaft.
„Es ist schon eine Menge Material zum Attentat gekommen“, erstattete Paul Bericht. „Aber eher Belangloses über Beileidskundgebungen, Trauerfeiern und die Überführung der Leichen. Man scheint noch weitere Bomben gefunden und noch mehr Verhaftungen vorgenommen zu haben. In Bosnien weiten sich offenbar die antiserbischen Demonstrationen aus. Ich hoffe, die Berichte werden noch etwas handfester.“
„Im Sport gibt es leider auch nichts Gutes“, fiel Theo jetzt eifrig ein, ganz offensichtlich bestrebt, von seinem Faux pas abzulenken. „Otto Froitzheim ist bei den Tennisweltmeisterschaften geschlagen worden. Von diesem Australier Norman Brookes. Dabei war er in der Vergangenheit immer besser als Brookes gewesen.“
„Und wie sind die Wettkämpfe der Damen ausgegangen?“, erkundigte sich Eva. Theo schien einfach noch nicht gelernt zu haben, dass inzwischen auch Frauen Sport trieben.
Doch er wusste Bescheid: „Elizabeth Ryan hat eine Miss Mitchinson geschlagen. Aber sagen Sie bloß nicht, dass Sie eine der beiden kennen, Fräulein Hoffmann.“
„Genausowenig wie die Herren Brooker und Froitzheim“, entgegnete Eva fröhlich.
Theo warf ihr noch einen abgrundtief verachtungsvollen Blick zu, und fuhr dann an ihren Vater gewandt fort: „Es muß ein tolles Spiel gewesen sein.“ Natürlich war er schon wieder bei der Partie der Herren. „Erst hat Brooker zwei Sätze gewonnen, dann Froitzheim und im fünften Satz hat es schon 6:6 gestanden.“
„Ja, sehr schön“, entgegnete sein Chef uninteressiert. „Und wie steht es in Albanien?“
„Prinz Wilhelm scheint einen Waffenstillstand mit den Aufständischen geschlossen zu haben. Auf den Rat seines Ministers Turkan Pascha hin und ohne den Kommandanten der Holländer um Rat zu fragen. Außerdem ist Prenk Bibdoda wohl wieder aufgetaucht. Trotzdem spekuliert man in Wien schon ganz offen über eine Abdankung des Prinzen. Seine Lage ist wirklich verzweifelt und echten Rückhalt hat er nur noch in einigen Hafenstädten.“
Arthur Hoffmann nickte. „Bleiben sie am Ball, Paul. Diese Geschichte mit Albanien ist wirklich heiß. Was Neues aus Mexiko?“
„Nicht Bestimmtes! Venustiano Carranza soll mit seinen Rebellentruppen auf dem Vormarsch sein, Emiliano Zapata eine Operation an der Westküste planen und Präsident Huerta Fluchtgedanken hegen.“
„Ich sehe, Sie kommen zurecht, meine Herren. Ich werde inzwischen drüben in der Anzeigenabteilung nach dem Rechten sehen. Du kannst hierbleiben, Eva, das würde dich nur langweilen.“
„Hast du nicht irgendwelche Arbeit für mich?“, drängte Eva Charlotte ihren Vater.
„Vielleicht später, mal sehen“, erwiderte er eilig. „Ich bin in einer Stunde wieder zurück.“
Er hastete zur Tür hinaus, Theo und Paul gingen wieder an ihre Pulte zurück, redigierten schweigend Fahnen des Wolffschen Telegraphenbüros, der wichtigsten deutschen Nachrichtenagentur, und klingelten ab und zu nach dem Redaktionsdiener, um die fertigen Texte in die Setzerei bringen zu lassen. Bruno, hinten in der Ecke an seinem Tisch, war so in seine Arbeit versunken, dass er nicht einmal aufgeblickt hatte, als sein Chef und Eva hereingekommen waren. Mit Vehemenz, als attackiere er einen Feind, drosch er mit der Feder auf das Papier ein und ebenso energisch strich er dann wieder ganze Zeilen aus. Da anscheinend keine spannenden Neuigkeiten zu erwarten waren, nahm Eva sich die Fortsetzungsromane in den Morgenzeitungen vor.
„Na, spannende Lektüre?“, erkundigte sich der alte Johannsen irgendwann väterlich.
Eva verzog das Gesicht: „Sterbenslangweilig! Ich weiß genau, wer die Täter sind. Sie müssen nur noch überführt werden. Ich würde wirklich gerne wissen, was noch passieren soll. Oh, halt! Einer der Kommissare ist immer noch verschollen. Das hatte ich ganz vergessen. Aber dieser Krimi ist wirklich so schlecht, dass man sich kein bißchen Sorgen um seine Helden macht.“ Sie legte die Norddeutsche mit der schon gewohnten Enttäuschung weg und griff nach dem nächsten Blatt.
Sie merkte nicht, wie Theo sich über ihre Schulter beugte: „Na, Evalotte, was lesen wir denn da Hübsches?“ Eva wollte die Zeitung wegziehen, aber Theo legte schnell die Hand darauf, um sie festzuhalten. Laut begann er vorzulesen: „’Er wollte sie an sich ziehen, aber sie funkelte ihn aus bösen schwarzen Augen an und stieß ihn zurück. Mit drei, vier raschen Schritten war sie bei der Tür, dann plötzlich, wie ein vom Sturmwind willenlos dahingewirbeltes Blatt, war sie wieder bei ihm, zog seinen Kopf zu sich nieder und küsste ihn auf Augen, Stirn, Haar und Mund, wohin immer ihre heißen, dürstenden Lippen trafen: ‚Du-du-du! Dass ich dich so lieben muss! Mein Götzenbild, mein Gott, mein Alles!’’ Evalotte, ich wusste gar nicht, dass sie so verdorben sind! Weiß ihr Vater denn von ihrer Lektüre?“
„Mein Vater hat mir noch nie die Kreuzzeitung verboten“, fauchte Eva ihn wütend an.
„Die Kreuzzeitung?“ Theo war überrascht und musste sich selbst vergewissern. „Das hätte ich denen am allerwenigsten zugetraut. Klang eher nach dem Lokalanzeiger.“
Bruno kicherte: „Du kennst eben die Phantasien alter Militärs nicht.“
„Und wie geht das weiter?“, wollte Theo begierig wissen. „Schweinisch?“
Paul drehte sich an seinem Pult um und warf seinem Kollegen einen bitterbösen Blick zu: „Hör endlich auf, Theo!“
Eva fand die Angelegenheit plötzlich wieder sehr spaßig, und hatte vielmehr Lust, Paul ein wenig zu ärgern, als sich an Theo wegen der Bloßstellung zu rächen. „Bei der Dame mit den schwarzfunkelnden Augen und den heißen Küssen handelt es sich selbstverständlich um die Böse“, begann sie zu erklären. „Die Gute, die sich junge Mädchen zum Vorbild nehmen sollten, sitzt währenddessen – sehr lieblich, in dunkelblau und weiß gestreifter Bluse, das feine Köpfchen von silberflimmernden Blondhaar umgeben, mit schönen, traurigen Kinderaugen – mit dem Vater des Angebeteten und der Haushälterin an der Teetafel.“
„Und Evalotte?“, lachte Theo. „Welche von den beiden nehmen Sie sich zum Vorbild?“
Eva sah ihn sehr liebenswürdig an: „Meine Vorbilder finde ich in der Kreuzzeitung bestimmt nicht im Fortsetzungsroman, sondern allenfalls im politischem Teil.“
Theo verstand ganz offensichtlich nicht, und Eva konnte beobachten, wie auch Paul hinter ihm verständnislos die Stirne runzelte, und sich dann mit einem Schulterzucken wieder seiner Arbeit zuwandte.
„Haben Sie schon gelesen, was die Kreuzzeitung zum Luxemburgprozess bringt?“, ließ sich da Bruno vernehmen, und Eva konnte zusehen, wie sich auf den Gesichtern von Theo und Paul Fassungslosigkeit breit zu machen begann. Vor allem Paul kämpfte ganz offensichtlich mit der Frage, ob er tatsächlich richtig verstanden hatte. Doch so langsam wurde Eva bewusst, was Bruno ihr selber hatte sagen wollen. Sie blätterte den vorderen Teil auf und sah sofort, dass ausführlich berichtet wurde. Jeder Anklagepunkt, von dem Bruno erzählt hatte, war säuberlich aufgeführt.
„Oh, verdammt“, zischte sie, allerdings so leise, dass Paul, Theo und der alte Johannsen sie nicht hörten. Wie sollte sie nur ihre verlorene Wette begleichen, ohne zu riskieren, dass ihr Vater sie nie wieder in die Redaktion ließ?
Als ihr Vater wieder kam, teilte er ihr großzügig mit, dass sie ein paar Anzeigen abtippen durfte. Eva fand, dass er ihr so langsam etwas Anspruchsvolleres zutrauen konnte. Aber wie ihm das beibringen?
Nach zwei Stunden taten ihr die Finger weh und sie war gar nicht traurig, daß sie aufbrechen mußte, um zum Nestabend ihrer Wandervogelhorde zu kommen. Das Ganze hieß Nestabend wie bei den Jungen, fand aber um drei Uhr Nachmittag statt, weil es für Mädchen natürlich undenkbar war, spät am Abend unbegleitet nach Hause zu gehen. Das Nest war ein Gartenhaus, auf dem weitläufigem Grundstück der Hergesells. Frieda Hergesell leitete die Gruppe der weiblichen Wandervögel. Wobei leiten nicht der richtige Ausdruck war. Im Grunde lehnten die Wandervögel Rangordnungen ab. Leider lehnten jedoch die meisten Eltern ab, ihre Kinder, vor allem Töchter, an Unternehmungen teilhaben zu lassen, bei denen keine volljährige Person die Aufsicht führte. Frieda war dreiundzwanzig und angehende Lehrerin. Eva fand, dass sie zu oft in einen liebevoll-zurechtweisenden Ton verfiel, der vielleicht zehnjährigen Schulmädchen gegenüber angebracht war. Möglicherweise hätte eine Eva Charlotte Hoffmann ihn sich auch als zehnjähriges Schulmädchen nicht gefallen lassen. Im Alter von achtzehn und von einer gleichrangigen Wanderschwester fand sie ihn unaktzeptabel und ließ Frieda das auch spüren.
Diesmal drehte sich natürlich alles um die gevorstehende Sommerfahrt ins Saaletal. Natürlich handelte es sich nicht um eine „Fahrt“ im eigentlichen Sinne, weil die Mädchen nicht wie die Burschen herumziehen und unter freiem Himmel oder bei irgendeinem Bauern in der Scheune übernachten konnten. Stattdessen würden sie die zwei Wochen in einem Landheim der Jenaer Wandervogelgruppe verbringen. Und es entspann sich die gleiche Diskussion wie vor jeder Fahrt. Eva, Rike und Lilo bestanden darauf, dass trotzdem ordentlich gewandert würde und nicht nur auf der Wiese vor dem Quartier Ringelreihen getanzt, worauf sich dann Inge als Wortführerin der Tanzliebhaberinnen vehement zur Wehr zu setzen pflegte und wieder einmal darauf verwies, dass Kreistänze zum kulturellen Erbe des deutschen Volkes gehörten und deshalb auch wesentlicher Bestandteil des Wandervogel-Daseins seien.
„Und überhaupt sind wir nun mal Mädel und keine Burschen“, wagte Elschen beizupflichten. „Da kommt es doch mehr darauf an, es sich in unserem Nest gemütlich zu machen, auch auf der Fahrt.“
„Mumpitz“, platzte Rike heraus. „Im Nest gemütlich machen, können wir es uns das ganze Jahr über in Berlin. Auf der Fahrt wollen wir doch was erleben.“
Allein das Wort „erleben“ ließ Elschen schon wieder panisch gucken.
„Ich will aber nicht ständig Gewaltmärsche machen“, stellte Inge klar.
„Wir werden beides machen“, versuchte Frieda den Streit zu schlichten. „Natürlich werden wir wandern, aber auch Tanzen und Singen und schöne Dinge basteln. Schließlich gehört auch die Pflege der Weiblichkeit zum Wandervogel.“
„Das erzählen wir doch nur den Eltern, damit sie ihre Töchter bei uns mitmachen lassen“, entsetzte sich Eva.
„Aber Hans Breuer hat auch gesagt, dass Mädchen lieber spielen und Tanzen sollen, statt Gewaltmärsche machen“, führte Inge leidenschaftlich an. „Er sagte auch, dass es keine Gleichmacherei von Mädchen und Jungen geben soll und es bei den Mädchen mehr auf die Vertiefung des Gemütslebens und Harmonie und Häuslichkeit ankommt.“
Eva lag auch ein „Mumpitz“ auf der Zunge, dann aber verwies sie lieber darauf, dass der langjährige, verdienstvolle Bundesleiter des Wandervogels Breuer mit dem diktatorischen Regime von Wandervogelgründer Karl Fischer gebrochen hatte und den einzelnen Ortsgruppen mehr Entscheidungsbefugnisse eingeräumt. Und darum sei, die Frage, wie viel eine Mädchengruppe auf ihrer Fahrt wandern wolle, eben nur Sache dieser Mädchengruppe.
Schließlich hatte Frieda es dann doch wieder erreicht, dass alle den üblichen Kompromiss zwischen Wandern und ruhigeren Tätigkeiten zustimmten.
„Singen wir zum Abschluss noch etwas?“, schlug Lotti, die Jüngste, vor.
Doch da räusperte sich Lilo. „Ich hätte noch etwas“, erklärte sie mit fester Stimme. Ihre Wanderschwestern stöhnten mehr oder weniger laut. Wenn Lilo so auftrat, drohte es meist sehr anstrengend zu werden. „Ich möchte aus dem Grußwort vorlesen, dass Ludwig Klages letztes Jahr zum Meißnertreffen der Freien Deutschen Jugend geschrieben hat“, verkündete sie. „Über die Zerstörung der Natur. Ich meine jetzt, wo wir uns wieder anschicken, raus in die freie Natur zu ziehen, nicht nur für einen oder zwei Tage, sondern für zwei Wochen, da sollten wir uns wieder einmal bewusst werden, dass wir zu einem größeren Ganzen gehören. Wir sind Teil der Natur und genauso wie sie durch den angeblichen Fortschritt bedroht wird, zerstört dieser Fortschritt auch ein wirkliches, natürliches, harmonisches Leben der Menschen im Einklang mit der Natur.“ Während die meisten ihrer Freundinnen schon genervt die Augen verdrehten, kramte sie ein zerlesenes Buch aus ihrer Handtasche, blätterte so hastig darin, als wolle sie unbedingt einem Protest aus den Reihen der anderen zuvorkommen, stand dann auf und begann mit lauter, anklagender Stimme zu lesen:
„’Unter dem schwachsinnigsten aller Vorwände, dass unzählige Tierarten ‚schädlich’ seien, hat er, der ‚moderne Mensch’, nahezu alles ausgerottet, was nicht Hase, Rebhuhn, Reh, Fasan und allenfalls noch Wildschwein heißt. Eber, Steinbock, Fuchs, Marder, Wiesel, Dachs und Otter, Tiere, an deren jedes die Legende uralte Erinnerungen knüpft, sind zusammengeschmolzen, wo nicht schon völlig dahin; Flussmöwe, Seeschwalbe, Kormoran, Taucher, Reiher, Eisvogel, Königsweihe, Eule rücksichtsloser Verfolgung, die Robbenbänke der Ost- und Nordsee der Vertilgung preisgegeben. Man kennt mehr als zweihundert Namen deutscher Städte und Dörfer, die vom Biber stammen, ein Beweis für die Ausbreitung des fleissigen Nagers in früheren Zeiten; heute gibt es noch wenige Restkolonien in der Elbe zwischen Torgau und Wittenberg, die auch schon verschwunden wären ohne gesetzlichen Schutz! Und wer gewahrt nicht mit heimlicher Angst die von Jahr zu Jahr schnellere Abnahme unserer lieblichen Sänger, der Zugvögel! Noch vor knapp einem Menschenalter war selbst in den Städten zur Sommerszeit die blaue Luft vom Schwirren der Schwalben und Segler voll, ein Laut, durch den die Ferne und aller Wandertrieb zu ziehen scheint. Damals zählte man in einem Vorort Münchens an die dreihundert bewohnte Nester, heute sind es noch vier oder fünf. Sogar auf dem Lande ist es unheimlich still geworden. Schon muss man es zu den Glücksfällen rechnen, wenn man auf entlegenem Waldespfad aus sonnigem Wiesengrunde wieder einmal den lichten und ahnungsvollen Ruf der Wachtel hört, die früher zu Tausenden und aber Tausenden die deutschen Gaue erfüllte und in den Liedern des Volkes der Dichter lebt. Elster, Specht, Pirol, Meise, Rotschwänzchen, Grasmücke, Nachtigall – sie alle schwinden, wie es scheint, unaufhaltsam dahin. Seit im Jahre 1908 in Kopenhagen eine Aktiengesellschaft entstand ‚zum Betrieb von Walfischfang in großem Stile und nach einer neuen Methode’, nämlich mit schwimmenden Fabriken, wurden im Laufe der beiden folgenden Jahre rund fünfhunderttausend dieses größten Säugers der Erde hingeschlachtet, und der Tag ist nahe, wo der Wal der Geschichte und den Museen angehört.’“ Atemlos geworden machte Lilo Pause, blätterte aber hastig ein Stück weiter. „’Wir sollten endlich aufhören zu vermengen, was im Tiefsten gespalten ist: Die Mächte des Lebens und der Seele mit denen des Verstandes und des Willens. Wir sollten einsehen, dass es zum Wesen des rationalen Willens gehöre, den ‚Schleier der Maja’ in Fetzen zu reißen, und dass eine Menschheit, die solchem Willen anheimgegeben, in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, verheeren müsse, bis alles Leben und schließlich sie selbst dem Nichts überliefert ist. Keine Theorie und Praxis bringt zurück, was einmal verloren wurde.’“
Aufatmend lies Lilo ihr Buch sinken und blickte erwartungsvoll in die Runde. Zuerst sagte keine der Freundinnen etwas. Alle wichen Lilos forderndem Blick verlegen aus. Else Heinz hielt es als Erste nicht mehr aus. Sie wurde puterrot und stieß dann verlegen hervor: „Ja, das ist gewiss alles sehr schlimm! Wie gut, daß wir Wandervögel da keinen Anteil daran haben.“
„Aber du hast Anteil daran, Elschen“, fiel Eva wieder mal boshaft ein. „Mit jedem Löffel Lebertran, den du frühmorgens schluckst, nimmst du einen Teil jener erbarmungslos dahingeschlachteten Wale zu dir.“
Elschens Miene verwandelte sich wieder mal in verständnisloses Entsetzen. Sie vergaß vor Schrecken fast zu atmen. Aber Inge und Lotti sahen nicht viel weniger entgeistert aus.
Lilo aber war begeistert, ob dieser unerwarteten Schützenhilfe: „Ich finde, es sollte für uns Wandervögel eine Regel werden, dass wir kein Fleisch und Fett von Tieren zu uns nehmen. Denn sonst werden wir Teil der grausamen Vernichtung der Natur, wo wir doch erstreben, in Harmonie mit ihr zu leben.“
Doch Eva bewies gleich, dass sie keine verläßliche Bündnispartnerin war. „Leder“, warf sie in die Runde. „Natürlich dürfen wir dann auch kein Leder tragen, keinen Pelz ... Ein Fischbeinkorsett trägt hoffentlich sowieso keine mehr von uns...“
„Aber man muss doch Schuhe tragen“, rief Inge entsetzt aus.
„Wie ist das mit diesen Naturmenschen vom Monte Veritá, von denen du immer erzählst, Lilo?“, erkundigte sich Eva scheinheilig. „Gehen die auch im Winter barfuß?“
Man sah Lilo an, dass sie angestrengt nachdachte. „Sie tragen Sandalen.“
„Aus Bast oder Holz?“, wollte Eva wissen.
Die anderen blickten immer noch völlig verwirrt drein.
Frieda mischte sich ein. „Ich glaube, wir sollten das Politisieren lassen. Schließlich sind wir Wandervögel und kein Debattierklub.“
Während rundherum erleichtertes Aufatmen zu hören war, fuhr Lilo wütend auf: „Wenn wir nicht nur blind durch die Welt wandern wollen, sondern in der Natur unsere Lehrmeisterin sehen, die uns zeigt, was Freiheit, Wahrheit und Einfachheit bedeuten und wenn wir dort wirklich Heilkraft für unsere Seelen finden wollen, die durch das eingesperrte Leben in der Stadt geschädigt sind, dann dürfen wir uns nicht an ihrer Zerstörung beteiligen.“
„Aber das tun wir doch nicht, Lilo“, versuchte Frieda zu beschwichtigen.
„Wir tun es“, giftete Lilo. „Wir tun es beispielsweise, wenn wir uns vom Fleisch aus menschlicher Gier getöteter Kreaturen ernähren.“
„Du lieber Himmel, Lilo“, mischte sich Rike entsetzt ein. „Du willst doch nicht etwa sagen, dass wir kein Fleisch und keinen Speck mehr essen sollen? Selbst, wenn wir es geschenkt bekommen?“
„Genau das meine ich“, beharrte Lilo trotzig. „Wir sollten uns, bevor unsere Fahrt beginnt, darüber einig werden, dass wir als Wandervögel an einem derartigen Morden nicht teilnehmen können.“
„Das kannst du nicht ernst meinen, Lilo“, jammerte Hedi. „Immer nur Brennessel- oder Sauerampfersuppe ohne das kleinste Fitzelchen Fleisch… Von was sollen wir da satt werden?“
„Von Kartoffeln und Brot“, schlug Lilo verbissen vor.
„Brot kriegen wir aber fast nie“, warf Inge ein.
Obwohl sie nicht wie die Jungen über Land zogen, versuchten auch die weiblichen Wandervögel möglichst weitgehend von der Natur zu leben. Den Rest allerdings kauften sie und gingen nicht bei den Bauern betteln. Offiziell! Es gab jedoch nicht wenige Bauern, die an Wandervögel gewohnt waren und auch eine Mädchengruppe mit Instrumenten auffordeten: ‚Dann singt mal schön. Sollt auch was kriegen dafür!’
„Was ist mit Eiern, Lilo?“, erkundigte sich Lea.
Offensichtlich hatte Lilo dieses Problem bisher übersehen. Sie dachte nach.
„Du hast die Fabriken vergessen“, legte Eva nach. „Ich habe Klages auch gelesen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er auch beklagt, dass die giftigen Abwässer der Fabriken das lautere Nass der Erde verjauchen. Wenn wir nicht an der Zerstörung der Natur teilnehmen wollen, dann dürfen wir auch keine Produkte mehr benutzen, die aus einer Fabrik stammen. Sei es eine Straßenbahn oder ein Rock, der nicht aus handgesponnenem Stoff gefertigt ist.“
Lilo war ganz blass geworden. „Du bist gemein, Eva“, fauchte sie. „Zynisch und gemein. An Wesen wie dir liegt es, dass …“
„Lilo“, unterbrach Frieda energisch. „Das geht zu weit. Wir sind eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Wir sind zusammen, um gemeinsam zu wandern, zu musizieren, zu singen, nicht um einander zu beschimpfen. Wir werden darüber abstimmen, ob wir auf unserer Fahrt Fleisch und Speck akzeptieren oder nicht. Aber dann ist das geregelt, und kein böses Wort mehr! Wer ist für Lilos Vorschlag?“
Inge wandte betreten den Blick ab, Elschen wurde puterrot und schien krampfhaft zu überlegen. wie sie es vermeiden konnte, weder mit Lilo noch den Fleischbefürworterinnen in Konflikt zu geraten, Hedi musterte angestrengt ihre Hände, Lotti fing an im Zupfgeigenhansl zu blättern.
Rike brach resolut das Schweigen: „Ich bin dagegen.“
„Von mir aus können wir auf Speck und Schweinefleich verzichten“, meinte Lea grinsend.
„Bei dir ist das etwas anderes“, maulte Hedi.
„Ich bin auch dagegen“, erklärte Eva in bemüht sachlichem Ton.
„Gut“, meinte Frieda aufatmend. „Das wäre geklärt. Tut mir leid, Lilo.“
Lilo kämpfte mit wütenden Tränen. „Dann kann ich an der Fahrt nicht teilnehmen“, würgte sie hervor.
„Aber, Lilo“, rief Elschen erschrocken aus. „Du musst doch kein Fleisch essen, wenn du nicht willst. Ich meine...“ Sie stockte, als sie die abweisenden Mienen der anderen sah.
Hedi griff den Faden auf. „Aber es wäre ganz schön mühsam, zweimal zu kochen. Schließlich braucht Fleisch viel länger als Gemüse.“
„Quatsch“, fiel ihr Lea ins Wort. „Ich bin bisher auch immer satt geworden, ohne Schweinefleisch essen zu müssen – und was anderes ist sowieso zu teuer. Warum sollte es nicht auch für Lilo gehen?“
„Natürlich wird es gehen“, beendete Frieda die Diskussion. „Es gibt für dich keinen Grund daheimzubleiben, Lilo. Wir sind eine Horde, und natürlich machen wir unsere Fahrten alle gemeinsam.“
Lilo erwiderte nichts und sah keinen an.
„Und jetzt lasst uns noch etwas singen“, fuhr Frieda munter fort.
Mit einem Schlag machte sich ungeheuere Erleichterung breit.
„Wohlauf ihr Wandersleut’“, schlug Lotti begeistert vor und griff schon nach ihrer Laute.. Rike holte ihre Gitarre aus der Ecke, Hedi packte die Flöte aus und alle begannen in ihren Liederbüchern zu blättern. Bald darauf sangen sie, als würde keinem auffallen, dass Lilo immer noch mit der Fassung kämpfte und Eva nur spöttisch vor sich hin grinste.
Nach dem letzten Lied machte sich die Gruppe wie üblich gemeinsam auf den Heimweg. Inge und Hedi hielten ein Gespräch darüber aufrecht, wie schön die Saaletal-Fahrt werden würde. Doch nachdem sie die Schlossstraße überquert hatten, musste auch Hedi nach rechts und Eva, Lea und Lilo gingen allein weiter nach links.
„Glaubst du wirklich, dass du jemandem wie unserem Elschen jemals beibringen kannst, dass es Zusammenhänge zwischen Dingen gibt, Lilo?“, brach Eva plötzlich das Schweigen.
Lilo fuhr jäh zu ihr herum: „Mag sein, dass Else oder Inge nicht verstehen, worum es geht. Aber du tust es! Und du machst dich nur darüber lustig! Das finde ich schlimm! Else kann nichts dafür, dass sie begriffstutzig ist, aber du kannst etwas für deinen Zynismus!“
„Ich benutze nur meinen Verstand“, wehrte sich Eva.
„Oh ja“, höhnte Lilo. „Und man sieht ja, wo dieser hochgepriesene Verstand uns hingebracht hat: Sie nennen es Fortschritt, in Wirklichkeit aber machen sie nur die kostbarsten Güter dieser Erde kaputt.“
„Ich sehe es anders“, konterte Eva. „Wenn der Fortschritt die Natur zerstört, dann ist zu wenig, nicht zuviel Verstand eingesetzt worden. So ist das nämlich.“
Lilo überzeugte sie nicht. „All diese Zerstörung hätte erst gar nicht passieren dürfen. Und es gibt nur eines, was wir tun können, um die Natur, die Menschheit und den ganzen Kosmos zu retten: Wir müssen sofort mit diesem Wahnsinn aufhören.“
„Willst du wieder ohne Elekrizität leben, ohne eine andere Heizung als ein Holzfeuer, ohne Straßenbahnen und Eisenbahnen und Warenhäuser? Willst du deine Kleidung selbst spinnen und weben, dein Haus mit der Hand bauen und nichts essen, als was du selber auf deinem Acker anbauen kannst?“
„Ich bin sicher, wir wären alle glücklicher, wenn wir es täten“, gab Lilo mit unverminderter Leidenschaft zurück.
„Ich glaube nicht, dass von ‚alle’ die Rede sein kann“, wandte Eva ein. „Vielleicht wären ein paar Menschen glücklicher. Aber denen steht es ja offen, sich auf den Monte Veritá oder an ähnliche Orte zurückzuziehen. Ich habe kein Verlangen danach und die meisten anderen Menschen, glaube ich, auch nicht.“
Lilo wollte zu einer heftigen Erwiderung ansetzen, doch da unterbrach Lea die beiden: „Lebt wohl, Wanderschwestern. Ich werde meinen Marsch nach Hause nun alleine fortsetzen. Liefert euch bitte keine Schlägerei mitten in unserem vornehmen Charlottenburg. Es wäre mir sehr unangenehm zu hören, dass euch die Polizei wegen Erregung öffentlichen Ärgnernisses festgenommen hat.“
Eva verabredete mit Lea noch einen Besuch für den nächsten Tag, während Lilo finster vor sich hin starrte. Kaum hatte Lea ihnen dann den Rücken zugedreht, fiel sie wieder über Eva her.
„Willst du, dass die Erde weiterhin zerstört wird? In den Städten ist doch alles nur Unruhe und Gift und leere Fassade! Statt Sterne gibt es Gaslicht, statt Vogelgezwitscher den Lärm von Automobilen und Straßenbahn, statt den Schönheiten der Natur Kino und Varieté. Und die Menschen stehen den lieben langen Tag in Fabriken, wo sie die Sonne nicht sehen und allerlei Giften ausgesetzt sind! Findest du das erstrebenswert?“
Eva stöhnte. „Glaubst du, es ist erstrebenswerter, sich seinen Lebensunterhalt mit Ackerbau zu verdienen? Frag doch mal einen Landarbeiter auf einem ostpreußischem Gut, was er von den Schönheiten der Natur hält!“
„Man sollte nicht meinen, dass ein Wandervogel so sprechen kann“, entgegnete Lilo verächtlich.
„Ich bin kein ostpreußischer Landarbeiter“, hielt ihr Eva ungerührt vor. „Ich weiß die Schönheiten der Natur durchaus zu schätzen. Allerdings auch die Angenehmlichkeiten der Stadt. Ich finde auch alles, was du über die Zerstörung der Natur sagst, richtig. Bloß meine ich, daß es Wichtigeres gibt, als dass man nur noch wenige Rotkehlchen singen hört. Ich finde, sowohl das Los der ostpreußischen Landarbeiter wie das der Fabrikarbeiter schlimmer! Oder die militärischen Rüstungen, die imperialistische Politik, die ganze Völker unterdrückt und knechtet, diese ständigen Kriegskrisen ... Ich finde es unehrlich, zu glauben, man wäre Teil der Natur, wenn man kein Fleisch mehr isst, aber sich nicht darum kümmert, dass sich viele Menschen die freie Zeit und das Straßenbahngeld gar nicht leisten können, um auch nur im den Grunewald zu fahren. Oder dass in Russland die Landarbeiter sogar noch Leibeigene sind und die Felder, auf denen sie schuften müssen, wahrscheinlich hassen. Egal, ob es dort noch Rotkehlchen gibt oder nicht.“
„Die Menschen auf dem Monte Verità sind glücklich“, widersprach Lilo fest. „Sie leben im Einklang mit der Natur, werden nicht unterdrückt und unterdrücken niemanden.“
„Und sie leben tatsächlich nur von dem, was sie selber anbauen? Sie kaufen nichts?“ erkundigte Eva sich misstrauisch.
Lilo wurde verlegen: „Sie haben einen Garten und Felder. Ob sie alle Lebensmittel selbst anbauen und ihre Kleidung selbst herstellen, weiß ich nicht. Schließlich kommen die meisten nur für ein paar Wochen oder Monate dorthin, um sich in der Naturheilanstalt von den Krankheiten zu kurieren, die das Leben in der Stadt mit sich bringt. Nur Henri Oedenkoven und seine Gefährtin Ida Hoffmann und einige andere wohnen dort in einer natürlichen Lebensgemeinschaft.“
„Dann verlangen sie wohl Geld für die Kuren, wie jedes andere Sanatorium auch.“
„Bestimmt nicht viel!“, verteidigte Lilo ihre Idole. „Und nicht, um sich zu bereichern! Aber wie könnten sie sonst die vielen Menschen, die dorthin kommen, unterbringen und ernähren?“
„Ist deine Tante noch dort?“
Lilo wurde verlegen: „Nein, sie wohnt jetzt wieder in München. Zusammen mit einem Mann, den sie auf dem Monte Verità kennengelernt hat.“
„Hat sie dir wieder geschrieben?“, erkundigte sich Eva eine Spur zu begierig. Sie fand die skurilen Geschichten von Lilos Tante immer sehr unterhaltam: Da gab es Leute, die sich nur von Kokosnüssen ernährten, weil sie fanden, dass alle anderen Nahrungsmittel zu nahe an der Erde wuchsen, oder andere, die aus Keuschheitsgründen Weintrauben ablehnten, weil die im alten Griechenland der Liebesgöttin Aphrodite geweiht gewesen waren. Einer hatte seinen Nachnamen Gräser in Gras umgewandelt hatte und verteilte Grashalme als Visitenkarte. Andere gingen auch im Winter barfuß, kleideten sich wie Jesus, sahen sich als Propheten an und hielten abstruse, religiöse Predigten. Wieder andere verkauften Postkarten von sich, auf denen sie nackt bei der Gartenarbeit zu sehen waren, bekehrten sich zum Buddhismus oder beteten Mond, Sonne und Sterne an und schrieben ihnen allerlei magischen Einfluss auf ihr Leben zu.
Lilos Eltern durften nicht einmal wissen, dass ihre Tochter mit Tante Emmi überhaupt in Kontakt stand. Lilo bekam ihre Briefe auf verschlungenen Wegen über Berliner Bekannte der Tante. Ihren Wanderfreundinnen gegenüber war sie jedoch immer offen mit diesem Geheimnis umgangen. Diesmal jedoch reagierte sie auf Evas Frage, ob sie wieder Post empfangen hatte, verlegen. Endlich rang sie sich zu einer Antwort durch: „Sie hat mir eine Schrift geschickt.“
„Wieder irgendwelche Traktate von diesem Oedenkoven?“
Lilo schüttelte den Kopf: „Es heißt ‚Vom Konflikt des Eigenen und Fremden’ und ist von einem Otto Gross.“
„Um was geht es?“, erkundigte Eva sich mit unverhohlener Neugier.
Lilo druckste herum und begann langsam wieder weiterzugehen.
Eva folgte ihr, immer mehr auf die Folter gespannt.
„Willst du es sehen?“, fragte Lilo schließlich.
„Natürlich, gerne!“
„Dann komm Samstag zu mir. Da sind meine Eltern nicht da.“
„In Ordnung.“
Im Hause Hoffmann hatte man noch nicht mit dem Essen begonnen. Eva fand ihren Vater mit dem üblichen Packen Abendzeitungen am Esstisch.
„Gibt es etwas Neues?“, fragte sie relativ uninteressiert. Lilos geheimnisvolles Gebaren beschäftigte sie gerade mehr als die Weltpolitik.
„Über Bibdodas Verbleib gibt es die wirresten Meldungen und die Vossische behauptet, der österreichische Gesandte in Belgrad habe Vollmachten erhalten, Serbien um Ermittlungen in Belgrad zu ersuchen. Und zwar durch österreichische Beamte, was ungewöhnlich ist, und wohl nicht auf allzugroßes Entgegenkommen in Serbien stoßen dürfte. Möchte mal wissen, woher sie diese Weisheiten haben und ob was dran ist.“
Da sie nichts Besseres zu tun hatte, nahm sich Eva die oberste Zeitung vom Stapel. Es war die Abendausgabe der Germania. Sie überflog die Seiten flüchtig, bis ihr Blick plötzlich an einem Artikel hängenblieb, der sie ärgerte. „’'Freund'l, der Thronfolger von Wien dankt Ihnen für ihr Anerbieten. Leben sie wohl und glücklich, meine Lieben.’“, zitierte sie mit hohntriefender Stimme.
Ihr Vater, der inzwischen bei der Kreuzzeitung angelangt war, schaute nicht hinter seinem Blatt hervor, als er fragte: „Wer sagt das?“
„Franz Ferdinand, der es scheinbar zu Lebzeiten liebte, unerkannt wie Harun Al-Raschid arme Bauern heimzusuchen. Ich glaube, die Germania würde ihn am liebsten heiligsprechen. Du hast Recht, sie sind wirklich schreckliche Weihrauchschwinger.“
Arthur Hoffmann registrierte das mit einem kurzen Auflachen, dann las er weiter und auch Eva vertiefte sich wieder in ihre Zeitung.
Die nächste Bemerkung kam von ihrem Vater: „Das ist gut! ‚Bezeichnenderweise ist es gerade der dem Vatikan nahestehende Corriere d'Italia, welcher erklärt, dass es in unserem Zeitalter nicht mehr angängig sei, selbst an sich noch so achtungswerte Ziele auf dem Wege blutigen Verbrechens zu verfolgen.’“
Eva kicherte: „Ist sogar schon der Vatikan so weit? Man sollte es nicht für möglich halten!“
Dann war es wieder sie, die etwas Interessantes fand: „Die Germania schreibt, dass der Figaro eine Vereinigung zwischen Serbien und Montenegro meldet.“
Diesmal fuhr ihr Vater auf: „Was? Lass sehen!“
„Hier! Seite drei, ganz kleine Meldung. Sie schreiben, beim letzten derartigem Gerücht, habe es in Österreich ein Riesengeschrei bis nahe an eine Kriegsdrohung gegeben.“
„Natürlich! Vereinigt mit Montenegro hat Serbien Zugang zur Adria.“
„Aber Österreich kann da doch nichts dagegen unternehmen, oder? Das geht doch wohl nur Serbien und Montenegro etwas an?“
„Wenn es um Serbien geht, meinen die Kameraden in Wien, dass sie das Recht haben, sich in so einiges einzumischen. Ich bin mal gespannt, was es diesmal für ein Gezeter geben wird“
„Könnte das wieder brenzlig werden?“
„Hoffen wir es nicht! Bei unseren Politikern werden die Österreicher jedenfalls keine Unterstützung finden, wenn sie meinen, sich in die Angelegenheiten zweier souveräner Staaten einmischen zu wollen. Und ohne Rückendeckung ist ihnen die Sache bestimmt zu heiß.“
„Wie war dein Nestabend?“, erkundigte sich Evas Mutter beim Abendessen. Eva berichtete über das Palaver bezüglich der Fahrt und auch über Lilos Antrag auf vegetarische Ernährung.
„Ich bin dir wirklich sehr verbunden, dass du nicht der Sekte der Kohlrabiapostel und Wurzelfresser beizutreten gedenkst“, bemerkte ihr Vater ironisch und verleibte sich mit demonstrativem Behagen ein Stück Hühnerfrikassee ein. „Leider muss ich dir trotzdem in einem Punkt widersprechen: Lebertran wird nicht aus Waltran, sondern aus Dorschleber gewonnen.“
„Tatsächlich?“, rief Eva entsetzt. „Wie überaus peinlich! Wenn die anderen das herausfinden, glauben sie mir nie wieder etwas.“
„Na, immerhin bist du keine Journalistin und hast diesen Unsinn in der Zeitung verzapft“, lästerte ihr Vater.
Eva ließ ihn mit einem bitterbösen Blick wissen, was sie von dieser billigen Kritik hielt. „Und wozu schlachtet man dann die armen Wale?“, lenkte sie ab.
Ihr Vater hob die Schultern. „Billige Fette für Kerzen, Seifen, Salben, Schminke. Solche Sachen.“
„Wir schmieren uns tatsächlich toten Wal ins Gesicht?“, vergewisserte sich Eva schockiert.
„Bitte, wir essen“, mischte sich ihre Mutter ein.
Doch inzwischen war Klein-Alfred aufmerksam geworden. „Was ist mit dem Wal? Warum ist er tot?“
„Gar nichts ist mit dem Wal“, beeilte sich seine Mutter zu sagen. „Dem Wal geht es gut.“
„Aber Eva hat gesagt: Der Wal ist tot. Ist er auch totgeschossen? Wie der Fanzferdinan? Von den Serbsen?“
Donnerstag, der 2. Juli 1914
Am nächsten Tag kletterte das Thermometer bereits früh morgens um acht Uhr auf 23 Grad. Am Himmel war nicht das Fitzelchen einer Wolke zu sehen. Eva und Lea beschlossen hinaus zum Wannsee zum Baden zu fahren. Ihre Eltern erlaubten ihnen, das Strandbad alleine aufzusuchen – vorausgesetzt, sie nahmen Klein-Alfred mit. Magda Hoffmann war der festen Überzeugung, dass ein Kleinkind eine äußerst abschreckende Wirkung auf Männer hatte, die auf Belästigungen aus waren. Eva hatte darüber schon einige Diskussionen mit ihrer Mutter gehabt. „Es gibt ein Männerbad und ein Frauenbad und dazwischen liegt noch ein Familienbad und alle drei sind durch hohe Wände voneinander getrennt. Wer soll uns da belästigen?“
„Die Wände haben Astlöcher. Außerdem kann man darum herumschwimmen. Zum Dritten warten solche Kerle auch gerne vor den Badeanstalten und haben dann „zufällig“ den gleichen Heimweg wie hübsche, unbegleitete Mädchen. Und zuguterletzt geht dein Bruder auch gerne Baden“, hatte Magda Hoffmann aber resolut klar gestellt.
Im Grund fand auch Eva, dass die Mitnahme des kleinen Bruders ein vertretbarer Preis für die Erlaubnis war, ohne Begleitung der Eltern Baden gehen zu dürfen. „Es ist wirklich lästig. Wir werden uns nicht richtig unterhalten können“, nörgelte sie gegenüber Lea trotzdem.
„Unsinn“, erwiderte die. „Er wird während der Zugfahrt die ganze Zeit fasziniert aus dem Fenster starren, wie er es immer tut, und wir können uns Bestens unterhalten.“
Das konnten sie natürlich nicht, denn obwohl es ein Wochentag war, schien halb Berlin auf dem Weg zum Wannsee zu sein. ‚Und die andere Hälfte steckt wahrscheinlich im Zug nach Grünau’, dachte Eva sarkastisch. Sie und Lea konnten nur noch Stehplätze in qualvoller Enge ergattern und Klein-Alfie, der eingequetscht zwischen lauter Erwachsene, gar nichts sehen konnte, jammerte die ganze Zeit.
An der Kasse des Strandbades durften sie dann Schlange stehen, um ihre 50 Pfennig Eintritt zu entlöhnen, und dann noch einmal vor den Umkleidezelten. Danach galt es, ein freies Plätzchen am Strand zu finden.
„Kaum zu glauben, dass es vor acht Jahren noch verboten war, in freier Natur zu baden, und man von der Polizei deswegen arretiert werden konnte“, meinte Eva, nachdem sie sich endlich aufatmend niedergelassen hatten. „Und inzwischen geht jeder baden und die Polizei bekämpft nur noch das wilde Nacktbaden an der Havel. Haben wir nicht Glück, dass wir im 20. Jahrhundert leben und nicht im 19.?“
„Auf das 20. Jahrhundert“, pflichtete ihr Lea bei.
Während sie mehr pro forma die Schäufelchen bewegten und gerade so viel zu Klein-Alfreds Burgenbau beitrugen, dass dieser nicht protestierte, studierten sie die Menge. „Schau mal, da hinten sind tatsächlich noch welche mit langen Strümpfen und Badeschuhen. Dabei sind sie doch gar nicht so alt.“
„Und die mit den Rüschen! Meine Güte, die hat an ihrem Badekostüm mindestens dreimal so viel Zierrat wie wir an unseren besten Kleidern!“
Eva und Lea trugen knielange Pluderhosen mit einer kurzen Tunika darüber, ohne Ärmel, aber mit nur nur kleinem, bravem Ausschnitt. Manche ihrer Schulkameradinnen führten mit ihren Eltern dagegen erbitterte Auseinandersetzungen um schickere und knappere Schwimmanzüge oder trugen sie heimlich. Aber beim Wandervogel war dergleichen verpönt. Wie überhaupt Liebeleien und „Rumpoussieren.“ Seit Moritz Odenwald sich als Enttäuschung heraus gestellt hatte, war auch Eva wieder entschiedene Verfechterin dieser Haltung. „Das sind doch alles nur dumme Gänse, die möglichst schnell einen Mann erobern wollen“, lautete ihr harsches Urteil über Mädchen, die sich zu sehr herausputzten. „Anstatt, dass sie froh sind, in ein paar Jahren volljährig zu werden, der Vormundschaft ihrer Eltern zu entkommen, einen Beruf ergreifen zu können ... Sie mögen die modernsten Kleider tragen: Aber geistig leben sie noch Anno Tobak.“
Deshalb kamen auch jene Badenixen, die unschicklich knappe Kostüme trugen, bei ihren und Leas Lästereien genauso schlecht weg, wie die, die sich noch zum Baden mehr an-, denn auszogen. „Sieh, die dort! Was für ein Ausschnitt! Wetten, für die ist der ganze Strandbadbesuch eine verlorene Angelegenheit, wenn keine Männer versuchen, herüberzuschwimmen?“
Natürlich forderten die Regeln des Strandbades anständige Bekleidung, doch da wurde genauso oft ein Auge zugedrückt, wie beim Herumschwimmen um die Trennwände.
Evas Blicke waren schon weitergewandert. „Und die Dicke da! Würdest du dich so in der Öffentlichkeit sehen lassen?“
„Pfui, schäm dich! Sie kann nichts dafür, dass sie so fett ist. Soll sie deswegen kein Recht haben, Baden gehen zu dürfen?“
„Aber doch nicht in einem so engen Schwimmanzug! Schau dir das doch einmal genau an! Würdest du so etwas tragen? Ich bestimmt nicht! Und das, obwohl ich nicht dick bin.“
Klein-Alfred begann sich über diesen Dialog vernachlässigt zu fühlen: „Wer ist dick?“, plärrte er so laut, dass alle umliegenden Badegäste es hören konnten und natürlich prompt die Köpfe drehten.
„Wir haben gesagt, dass du ein dickes Lob verdienst, weil du so schön baust“, schwindelte Eva schnell und in der gleichen Lautstärke wie ihr lästiger kleiner Bruder. „Aber jetzt gehen wir ins Wasser. Ich komme um vor Hitze.“
„Aber ohne Tunken“, forderte Alfie.
„Memme! Hast du keinen Schneid?“
Alfie hatte eine klare Meinung dazu. „Nein, will keinen Schneid“, erklärte er unverblümt.
Lea bekam einen Kicheranfall. „Der großen Schwester widersprechen. Das nenn ich Schneid!“ Sie musste es wissen. Sie war die Vierte von fünf Geschwistern.
Irgendwann aber vermochte auch das Wasser keine Abkühlung mehr zu bieten, obwohl Eva und Lea breitkrempige Florentiner Strohhüte als Sonnenschutz trugen. Aber als Wandervögel waren die Mädchen natürlich genug im Freien, um längst den angesagten goldbraunen Hautton erlangt zu haben. Andere Badegäste dagegen ließen sich in voller Sonne braten, um ihre Büroblässe loszuwerden und handelten sich natürlich nur eine krebsrote Farbe, Verbrennungen und Ekzeme ein.
„Lass uns wieder in die Stadt fahren und noch in ein Café gehen, wo es schön kühl ist und Eiskrem gibt“, schlug Eva vor.
Prompt protestierte ihr kleiner Bruder. Zwar wirkte auch er schon von der Hitze ganz ermattet, trotzdem wollte er um keinen Preis, den schönen Sandstrand verlassen, und hätte es mit Sicherheit aufregender gefunden, vor einem der Erfrischungszelte um lauwarme Limonade anzustehen, als in ein schnödes Café zu gehen.
„Aber Alfie“, versuchte es Lea begütigend. „Meinst du nicht, dass du auch lieber Eiskrem hättest? Was magst du denn gerne? Vielleicht Vanille? Oder Himbeer? Oder Ananas? Oder Tuttifrutti?“
Das Wort gefiel Klein-Alfred. Er beschloss, dass er Tuttifrutti-Eis haben wollte. Eva verdrehte die Augen. Im Gegensatz zu Lea wusste sie, wie hartnäckig ihr Bruder an einem einmal gefassten Gedanken festhalten konnte.
Das ausgewählte Café führte dann natürlich kein Tuttifrutti-Eis. Alfie drohte schon zu einem großen Geschrei anzusetzen.
„Haben Sie wirklich nichts, was man nicht als Tuttifrutti servieren könnte?“, flehte Eva die Bedienung an. Das Fräulein verstand. Was Alfie bekam, sah dann verdächtig nach Aprikose aus, aber er löffelte es unter falschem Namen und war zufrieden.
Arthur Hoffmann verbrachte unterdessen den Tag in der Redaktion. In den vergangenen Jahren war er um diese Zeit stets mit seiner Familie in der Sommerfrische an der Ostsee gewesen. Aber da nun seine Tochter nicht mehr und sein Sohn noch nicht in der Schule war, hatte er in diesem Jahr großzügig allen Familienvätern seiner Redaktion Urlaub gewährt und hielt aufopfernd mit dem alten Johannsen und den jungen, unverheirateten Kräften die Stellung. Jedenfalls hatte er die Sache seiner Frau so verkauft. „Wir können doch jederzeit wegfahren, Magda“, hatte er argumentiert. „Außerhalb der Saison ist es auch billiger und nicht so voll. Aber Kühne und Meier und Kopitzki, die wollen doch auch mal mit ihren Kindern …“ Seine Angetraute hatte dazu ergeben genickt, aber natürlich genau gewusst, dass ihr Mann heiße Sommertage bedeutend lieber bei der Arbeit verbrachte, als inmitten Tausender anderer Erholungsuchender an schattenlosen Sandstränden. Ihr war auch klar, dass ihr Mann die Engpässe, die durch seine großzügigen Urlaubsregelungen entstanden, gerne als Vorwand nutzte, um seine herausgehobene Rolle des Verlegers mit der eines Journalisten zu vertauschen und aktiv an der Blattgestaltung mitzuwirken.
Doch viel Weltbewegendes brachte dieser Donnerstag nicht. Die Meldungen aus Albanien über den Verbleib von Prenk Bibdoda blieben widersprüchlich. Die Untersuchungen zum Attentat von Sarajewo ergaben, dass die Attentäter ihre Waffen tatsächlich in Belgrad erhalten hatten. Von einem Freischärler namens Miho Ciganovic, über dessen Verbindungen in Regierungskreise man bislang nur spekulieren konnte. In den österreichischen Balkanprovinzen gab es anscheinend weitere antiserbische Ausschreitungen gegen Geschäfte, aber auch Privatwohnungen, wenn sich auch die 200 Toten von Mostar glücklicherweise inzwischen als Zeitungsente herausgestellt hatten. Ansonsten führten die serbischen und österreichischen Zeitungen einen heftigen Krieg gegeneinander, wie die Presseschauen der Telegraphenagenturen belegten.
„Dass sie in Serbien die Attentäter als Märtyrer bezeichnen und behaupten, bei der österreichischen Polizei würde gefoltert, das ist doch wirklich bodenlos“, regte Theo sich auf. „Da sieht man doch, was für eine Gesinnung in Serbien herrscht.“
„Stell dir vor, was man im Ausland für deutsche Gesinnung halten muss, wenn man nur die DTZ und dieses Leipziger Schmierblatt liest?“, konterte Bruno sofort.
Arthur Hoffmann war unterdessen in der Kreuzzeitung auf einen großen Vorbericht zu den Wahlen in Labiau gestoßen. Da der deutschkonservative Abgeordnete des ostpreußischen Kreises Anfang Juni gestorben war, war eine Nachwahl nötig geworden.
Der Verleger stieß schon bald auf Empörendes: „Hört euch das an! Die Kreuzzeitung behauptet, die vergangenen Wahlen wurden von der Fortschrittlichen Volkspartei durch ihr vieles Geld manipuliert“, teilte er seiner Redaktion mit.
Paul zog die Augenbrauen zusammen. „Sie werfen Betrug vor?“
„Das nicht gerade. Aber Propaganda. ‚Reinste, amerikanische Wahlmache, bei der Geld keine Rolle spielt’, heißt es hier. Dabei möchte ich nicht wissen, wie viel Geld die konserativen Großgrundbesitzer für ihre Kandidaten locker machen und mit welchen Methoden aus der Zeit der Leibeigenschaft sie ihre Landarbeiter zur ‚richtigen’ Stimmabgabe nötigen. Paul, kriegen sie doch raus, wer in Labiau für den Fortschritt kandidiert. Und dann melden wir ein Ferngespräch dorthin an und befragen den Mann zu seinem Wahlkampf und dem der Deutschkonservativen und deren Machenschaften.“
Paul registrierte den Auftrag mit einem Nicken. Chefredakteur Johannsen jedoch zweifelte:
„Ob das unsere Leser in Berlin hier interessiert?“
„Natürlich“, erklärte sein Arbeitgeber im Brustton der Überzeugung. „Unsere Leserschaft steht auf Seiten des Fortschritts und dieser ostpreußischen Gutsbesitzerbande ein Mandat abzuringen, ist immer noch eine besondere Genugtuung.“
Seine drei Jung-Redakteure registrierten diese Kampfansage mit einhelligem Grinsen.
Freitag, der 3. Juli 1914
Auch am nächsten Tag wurden wieder 30 Grad im Schatten gemessen und die Agenturen meldeten, dass angeblich in England bereits die ersten Leute wegen der anhaltenden Hitze irrsinnig geworden worden seien. Die Zeitungen empfahlen, angesichts der Temperaturen nur halb so viel wie sonst zu essen. Eva deckte sich bei Wertheim mit 2 Pfund Kirschen – für 25 Pfennige im Angebot – ein, bevor sie die Redaktion betrat, wo sie sich erst einmal die Zeitungen vornahm. Diesmal interessierte sie besonders der erste Kongress der deutschen Schriftstellerinnen, der in Leipzig begonnen hatte, aber zu ihrer großen Enttäuschung waren die abgedruckten Redebeiträge von ziemlich dürftiger Qualität. Wahrlich nichts um damit gegenüber den Männern zu renommieren!
Während sie dann wieder stupide Schreibarbeiten erledigte, hörte sie mit halbem Ohr mit, was es an interessanten Neuigkeiten gab. Anscheinend stand nun endgültig fest, dass dieser ominöse Prenk Bibdoda in Albanien doch nicht verschwunden war, was die Lage dort wohl etwas weniger kritisch erscheinen ließ. Außerdem berichtete die Germania, Wien hätte die Vereinigung von Serbien und Montenegro bestätigt. Doch weder in einem der anderen Blätter noch im Material der Telegraphenagenturen fand sich irgendetwas dazu. „Merkwürdige Geschichte“, meinte Arthur Hoffmann. „Na gut, bringen wir ein kleine Meldung. Aber schreibt deutlich rein ‚laut Aussage der Germania’, damit nichts an uns hängen bleibt, wenn die Weihrauchbrüder da etwas falsch verstanden haben.“ Dann machte er sich höchstpersönlich daran, einen Nachruf auf den ehemaligen britischen Handels- und Kolonialminister Joseph Chamberlain zu schreiben. „Sie kennen Josephus Africanus ja gar nicht mehr“, ließ er seinen jungen Politredakteur wissen. „Schließlich ist er bereits seit sechs Jahren aus dem Geschäft, seit seinem Schlaganfall.“
„Chamberlain war zweifellos bedeutend“, gab Paul zu, „aber doch auch sehr …“ Er suchte nach Worten.
„Bestimmt einer der merkwürdigsten Liberalen, die es je gab, und in jeder Hinsicht radikal“, gab sein Arbeitgeber zu. „Was er als Bürgermeister von Birmingham geleistet – Abriss der Elendsquartiere, Reform des Gesundheitswesens, Aufbau einer kommunalen Gas- und Wasserversorgung, allgemeine Schulpflicht, Gründung der Universität und so weiter – das war schon fast sozialistisch und hatte weit über Birmingham hinaus Wirkung. Außenpolitisch dagegen …“
„War er der Überzeugung, dass die Briten die edelste und tüchtigste Rasse auf dem ganzen Erdball sind und deshalb berechtigt über ihn zu herrschen“, warf Bruno ein.
Arthur Hoffmann musste lachen: „Aber trotzdem hat er Großbritannien aus seiner ‚splendid isolation’ herausgeholt und die Entente cordiale mit Frankreich eingefädelt, die niemand für möglich gehalten hätte.“
„Gegen uns“, warf Paul sarkastisch ein.
Arthur Hoffman seufzte. „Aber davor hat Chamberlain wirklich lange und intensiv um eine Allianz mit Deutschland geworben. Unseren Politikern standen alle Türen offen, den Dreibund mit Österreich und Italien um Großbritannien zu erweitern. Aber leider war unserem Kaiser sein verdammtes, antibritisches Flottenprogramm wichtiger. Das war wirklich eine Riesen-Dummheit.“ Er war ein leidenschaftlicher Befürworter eines deutsch-britischen Bündnisses und lehnte deshalb das maritime Wettrüsten gegen England ebenso leidenschaftlich ab. Die Vorstellung der Alldeutschen durch das Wettrüsten England zu einem noch günstigeren Bündnis zu zwingen, fand er nur lächerlich. Für ihn war die ganze Flottenpolitik Ausdruck des kaiserlichen Ehrgeizes, es seinen britischen Verwandten „zu zeigen.“ Eines überaus kindischen Ehrgeizes!
„Nun, Dummheiten und unser Kaiser …“, meinte auch Paul in resigniertem Tonfall. „Aber es war nicht nur der Kaiser. Es waren auch all diese Schreihälse vom Alldeutschen Verband und dem Flottenverein und so weiter, die eine Verbindung mit Großbritannien nur akzeptiert hätten, wenn die ihnen als Morgengabe noch ein paar Kolonien zu Füßen gelegt hätten.“
„Tja, der Lockruf des Kolonialismus“, meinte Arthur Hoffmann. „Dieser einfachen Vorstellung, dass man mit Kolonien über nahezu unbegrenzte Rohstoffe und ebenso unbegrenzte Absatzmärkte verfügt, ist schwer etwas entgegenzusetzen.“
„Das alles ist fürchterlicher Unsinn“, regte sich Paul auf. Eva hatte den gesetzten jungen Mann noch nie so in Rage gesehen. „Das mag im 19. Jahrhundert so gewesen sein, aber heute gilt das nicht mehr. Deutschland steht wirtschaftlich besser da als Großbritannien, und zwar nicht dank, sondern trotz unserer lächerlichen Kolonien, die fast allesamt mehr kosten als sie einbringen. Wir sind die zweitstärkste Wirtschaftsmacht hinter den USA und auf Gebieten wie der Chemie oder Elektrotechnik Weltspitze. Was wir für unsere Rohstoffe zahlen müssen, das ist in der Regel weniger als die Briten oder Franzosen der Unterhalt ihrer Kolonien kostet. Und als Absatzmärkte brauchen wir auch keinen afrikanischen Busch oder Südseeinseln, sondern andere Industrieländer, weil unsere Produkte viel zu teuer für unterentwickelte Länder sind. Jede einzelne Mark, die nach Togoland oder Kamerun oder gar nach Nauru oder Deutsch-Samoa fließt, wäre an Schulen und Universitäten besser angelegt. Denn da wird das Kapital geschaffen, das uns unsere Weltmacht verschafft.“
Arthur Hoffmann musste lachen. „Sie haben ja vollkommen Recht, Paul! Aber was hat die trockene Schulbank für einen Reiz im Vergleich zu Sandstränden mit Palmen, Goldminen und weißen Tropenanzügen? Ich fürchte, die Mehrheit unserer Landsleute wird das nie lernen. Machen Sie Mittagspause und ich schreibe unterdessen den Nachruf auf unseren feurigen Joe Chamberlain fertig. Eva, Mädchen, spring doch mal runter und hol mir bei Wertheim eine Dose Fleischsalat oder ein Stück Delikatess-Sülze und dazu bei Aschinger ein Bier!“
„Meinst du nicht, bei diesem Wetter wäre Obst gesünder?“, gab die zurück. „Ich gebe dir auch gerne von meinen Kirschen ab.“
Ihr Vater sah sie an, als wolle sie ihn vergiften und sie schob los, das Gewünschte zu holen. Sie hatte nichts dagegen, solche Aufträge zu erledigen. Solange ihr Vater nicht meckerte, dass sie Botengänge zu ihrer bezahlten Arbeitszeit dazuschlug!
Eva Charlotte ließ sich Zeit bei Wertheim. Natürlich war Wertheim am Moritzplatz nicht mit Wertheim in der Leipziger Straße zu vergleichen. Aber sie liebte es, in den großen Warenhäusern rumzustrolchen. Interessiert registrierte sie die Vorbereitungen auf den großen Ausverkauf, der am Samstag beginnen sollte. Dabei suchte sie gar nicht nach etwas Bestimmten. Selber Kleider zu kaufen, fand sie meist eher lästig. Aber Entdeckungen wie beispielsweise die, dass man den Preis von Korsetts um bis zu 70 Prozent senken musste, um noch Käuferinnen für so etwas zu finden, bereitete ihr Spaß. Schaudernd begutachtete sie ein paar besonders schreckliche Modelle, bevor sie in die Redaktion zurückkehrte.
Dort waren ihr Vater und Bruno, der den lästigen Kampf mit der Treppe für die Mittagspause nie auf sich nahm, konzentriert beim Arbeiten. Eva widmete sich wieder ihren restlichen Kirschen und der Zeitungslektüre.
„Komm, iss was Vernünftiges, Mädchen“, forderte ihr Vater irgendwann auf und schob ihr von seiner Sülze zu.
„Ich bin der Meinung, dass ich mich äußerst vernünftig ernähre“, gab sie zurück. „Aber sag mir doch bitte, was es mit dem Kmetensystem auf sich hat.“
Ihr Vater stöhnte. „Kannst du es einfach nicht lassen? Das Kmetensystem ist die Leibeigenschaft, die auf dem Balkan zur Zeit des Osmanischen Reiches geherrscht hat. Warum willst du das wissen?“
„Der Vorwärts schreibt, Österreich habe in Bosnien das Kmetensystem übernommen. Findest du das sehr unangemessen oder gar falsch?“
Arthur Hoffmann stöhnte noch einmal: „Was soll das, Evchen? Suchst du noch immer fleißig nach Indizien für die Mitschuld Österreichs an den Verhältnissen auf dem Balkan? Niemand bestreitet das! Die österreichische Regierung hat sich nach der Annexion Bosniens und der Herzegowina vor allem auf die muslimischen Agas und Beys gestützt, die auch in osmanischer Zeit schon das Sagen hatte. In gewisser Weise kann man ihnen da bestimmt ein Anknüpfen an das alte ungerechte System vorwerfen, auch wenn die Behauptung einer Fortführung natürlich übertrieben ist und die Leibeigenschaft selbstverständlich auch in den österreichischen Balkanprovinzen abgeschafft wurde.“
„In Galizien haben sie es genauso gemacht“, warf Bruno fröhlich ein. „Bei jeder Krise bekam der polnische Adel noch mehr Rechte. Er hat mittlerweile in Galizien vermutlich dreimals soviel Privilegien wie in Polen und steht ob dieser Tatsache nach anfänglichen Widerständen inzwischen fest und treu auf der Seite der Habsburgermonarchie. Aber für die ruthenischen oder ukrainischen Bauern dürfte sich seit den Tagen der Leibeigenschaft recht wenig geändert haben. Außerdem gibt es nicht nur Polen und Ruthenen in Galizien, sondern auch Deutsche, Juden, Ungarn, Moldawier, Armenier und eine Menge anderer Landsleute, die nicht gerade die Bilinskis oder Gołuchowskis als ihre natürlichen Herren ansehen. Ganz abgesehen davon, dass wir in einer Zeit leben, in der – wie unser kluges Paulchen heute morgen so richtig bemerkte – schon der Kolonialismus eine Wirtschaftsform von gestern ist. Die galizische Landwirtschaft aber ist so rückständig, dass sie selbst mit dem größten Fleiß und unter größtmöglicher Ausbeutung aller Arbeitskraft nur Armut produziert.“
„Woher wissen Sie das?“, erkundigte sich Eva.
Bruno hob die Schultern. „Ich durfte einst meine Kindertage in diesem Idyll verbringen. Aber von meiner Sippe ist keiner mehr dort. Die ganzen Deutschen, die mal geholt worden sind, um das Land wirtschaftlich voranzubringen, wandern in Scharen wieder aus. Wenn ihr mich fragt: K.u. k. kann nicht mehr gerettet werden. Wenn die Türkei der ‚kranke Mann am Bosporus’ war, dann ist Österreich der ‚kranke Mann an der Donau’. Und es wird seine nichtdeutschen Länder genauso zwangsläufig verlieren, wie das Osmanische Reich seine nichtürkischen. Deutschland sollte sich hüten, seine Geschicke zu eng mit den österreichischen zu verknüpfen. Dieses ganze Geschwätz von „unverbrüchlicher Nibelungentreue in den Tagen des Unglücks“ und „Zusammenrücken mit dem stammverwandten Brudervolk“, was jetzt wieder in der konservativen Presse beschworen wird, das ist gefährlich.“
Arthur Hoffmann schüttelte den Kopf. „Sie mögen ja in vielem Recht haben, Bruno, aber sie übersehen so einiges. Das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein überaus schönes Schlagwort. Aber wie soll das in der Praxis ausschauen? So wie in Galizien nicht nur Ruthenen leben, so wenig gibt es in Bosnien nur Serben. Die meisten Kroaten und Muselmane dort ziehen einen Verbleib bei Österreich – trotz allem – bei weitem einem Anschluss an Serbien vor. Und für Kroatien und die anderen von Südslawen bewohnten Regionen Österreichs gilt das noch viel mehr. Ich fürchte, wenn Österreich wirklich auseinanderbricht, dann stürzen gerade diese Länder ins Chaos.“
„Das kann sein“, stimmte Bruno zu. „Ich sage auch nicht, dass ich weiß, welche Entwicklung bevorsteht, und schon gar nicht, dass das, was kommt, besser wird. Aber die Habsburgermonarchie ist zum Tod verurteilt, da bin ich mir völlig sicher.“
Sein Arbeitgeber schüttelte noch einmal den Kopf: „Sie sehen zu schwarz, Bruno. Hoffe ich jedenfalls sehr.“
Eva fand, sehr überzeugt wirkte ihr Vater nicht. Und das „hoffe ich“ war in fast inbrünstigem Tonfall nachgeschoben worden.
Samstag, 4. Juli 1914
Am nächsten Tag befasste sich auch der Vorwärts in seinem Leitartikel mit der Zukunft Österreichs. Der Verfasser bezeichnete die Habsburgermonarchie als eine Gefahr für den Weltfrieden und forderte, sie in einen Bund freier Völker umzuwandeln. Bosnien meinte er, solle an Serbien angegliedert werden.
Eva Charlotte konnte sich nicht helfen: Aber sie fand ihre heimliche Lieblingszeitung auf einmal naiv. ‚Bund freier Völker’ und ‚Selbstbestimmungsrecht der Völker’ klang zwar wirklich schön und gut. Aber was war eigentlich ein Volk? Was war es in Bosnien? Es konnte doch wohl kaum die Lösung sein, wenn dort in Zukunft statt der alten muslimischen Eliten die Serben dominierten?
Sie zeigte Bruno den Artikel und fragte ihn nach seiner Meinung, aber er zuckte nur verachtungsvoll mit den Schultern. „Es ist vollkommen überflüssig, sich Gedanken über eine Reform des Habsburgerreiches zu machen“, erklärte er abfällig. „Es wird keine Reformen geben. Alles, was dort passieren wird, wird mit Gewalt passieren. Vielleicht hat Paulchen ja Recht und der Erzherzog hätte noch was bewirken können. Aber jetzt ist er tot und damit ist Österreichs letzte Chance vorbei. Aus! Amen! Tut mir leid!“
Von Theo wurde Eva mit einer Meldung aus Belfast geärgert. Dort hatten Sufragetten ein Schloss niedergebrannt. „Da sieht man, wohin es kommt, wenn man die Weiber vom Zügel lässt“, triumphierte Theo. „Sogar das Tageblatt spricht von Wahlfurien. Eine halbe Million Schaden hat es gegeben. Hier steht, dass das englische Volk jetzt langsam zur Selbsthilfe greifen muss, nach allem, was schon passiert ist: Verbrechen, Attentate, Brandstiftungen, Überfälle, Misshandlungen, Bombenwürfe und so weiter. Sogar in Westminster Abbey haben sie schon einen Bombenanschlag verübt. In einer Kirche! Das können Sie doch nicht gutheißen, Evalotte, oder?“
Konnte sie natürlich nicht. Selbstverständlich war Eva Charlotte Hoffmann eine glühende Anhängerin des Frauenwahlrechts. Aber genauso selbstverständlich war sie auch ein braves, wohlerzogenes Mädchen, dem man beigebracht hatte, das Bombenwürfe, Messerattentate, Säureanschläge oder auch nur das Einwerfen von Schaufensterscheiben kein Mittel der politischen Auseinandersetzung waren. Ehrlich gesagt, hatte sie nicht einmal richtig lachen können, als sie las, dass die britischen Frauenrechtlerinnen mit toten Katzen nach Premierminister Herbert Asquith geworfen hatten, um ihm ihre Verachtung zu demonstrieren. Stattdessen las sie die Berichte aus England oder Amerika immer mit geheimen Ärger, da sie der Meinung war, dass diese verrrückten und radikalen Damen alle Versuche unterminierten, zu beweisen, das Frauen vernunftbegabte und intelligente Wesen waren und deshalb ganz selbstverständlich das Wahlrecht verdienten. Nur in ganz, ganz geheimen Augenblicken war sie so wütend auf die Männerwelt, dass sie sich wünschte, skrupellos genug für Bomben- oder auch nur Steinwürfe zu sein.
„Was sagen Sie, Evalotte?“, bohrte Theo unverdrossen weiter. „Das spricht doch für sich! Solch hysterischen Furien kann man ja wohl wirklich nicht das Wahlrecht verleihen, oder?“
Eva Charlotte atmete tief durch, verbannte die Vorstellung, wie es sein mochte, Theo eine tote Katze um die Ohren zu schlagen, tief in die Abgründe ihrer Seele und erwiderte mit aller gespielten Ruhe, zu der sie fähig war: „Wissen Sie, Theo, ich würde Ihnen ja zustimmen, wenn Sie dafür wären, ruhigen, friedlichen, vernünftigen Frauen, das Wahlrecht zu geben. Da es aber offenbar keinen Unterschied macht, ob wir ruhig, friedlich und vernünftig sind oder Bomben schmeißen und Schlösser niederbrennen, um doch nicht wählen zu dürfen, wüsste ich nicht, warum ich groß über dieses Thema reden sollte.“
Theo öffnete den Mund zu einer Erwiderung. Doch offenbar war er für den Moment geistig überfordert. Der Mund blieb einfach eine Weile offen stehen. Dann machte er „Ph“ und wandte sich wieder seiner Arbeit zu, einem Bericht über ein Sommerskirennen auf dem Schweizer Aletschgletscher. Der Sieger hatte die sechs Kilometer lange Strecke in 12 Minuten und 25 Sekunden bewältigt.
Nachdem sie sowohl der Vorwärts wie die Frauenrechtsbewegung enttäuscht hatten, hoffte Eva, dass ihr wenigstens Lilos geheimnisvolle Schrift noch einen interessanten Nachmittag bescheren würde. Sie legte ihrem Vater die Schreibarbeiten auf den Tisch und erklärte: „Ich geh dann für heute. Ich bin mit Lilo Berger verabredet.“
„Wollt ihr Schwimmen gehen?“
„Wir sind doch nicht verrückt. In der Wannseebahn gibt es inzwischen wahrscheinlich Tote und der Eintritt ins Strandbad kostet am Wochenende eine Mark. Nein, sie will mir ein paar Bücher zeigen.“
„Herzergreifende Liebesromane für Backfische?“, zog ihr Vater sie auf und blickte kurz von seiner Arbeit auf.
Eva schenkte ihm einen strafenden Blick. „Nein, ich glaube nicht! Das Kommunistische Manifest soll eines davon sein.“
„Das hast du doch bestimmt schon selbst unter dem Kopfkissen liegen“, lästerte Arthur Hoffmann.
Seine Tochter grinste. Sie würde ihm bestimmt nicht verraten, wo sie Bücher versteckt hielt, die er nicht zu finden brauchte.
Lilo, die Eva noch nervöser als vor zwei Tagen erschien, holte das schmale Paket von ihrer Tante unter ihrer Matratze vor. „Wenn meine Eltern das jemals finden sollten, jagen sie mich bestimmt aus dem Haus“, flüsterte sie. Dann nahm sie eine dünne Broschüre aus dem Umschlag, gab sie Eva aber nicht, sondern hielt sie fest, während sie zu erklären begann: „Otto Gross schreibt über die Unterdrückung von Kindern durch ihre Eltern. Er sagt, dass Eltern ihre Kinder nur dann lieben, wenn die sich ihnen anpassen. Und weil kein Mensch schon als Kind auf Liebe verzichten kann, muss er sich also notgedrungen anpassen, obwohl es ihn in seinem angeborenem Wollen und seiner natürlichen Wesensart unterdrückt.“
Eva konnte sich gut vorstellen, dass Eltern wie die von Lilo angesichts solcher Thesen Gift und Galle spucken würden. Ihr eigener Vater würde wohl eher mit einigen spöttischen Bemerkungen reagieren, ihre Mutter mit Befremden und der vorsichtigen Frage, ob Eva sich denn unterdrückt fühle. Aber Eva war absolut unklar, warum das alles Lilo so verlegen und nervös machte. Sie beobachtete, wie die Freundin begann, hastig in dem Buch zu blättern.
„Hier steht es: ‚Die Angst der Einsamkeit, der Trieb zum Anschluss zwingt das Kind, sich anzupassen: die Suggestion von fremdem Willen, welche man Erziehung nennt, wird in das eigene Wollen aufgenommen. Und so bestehen die meisten geradezu allein aus fremdem Willen, den sie aufgenommen, aus fremder Art, der sie sich angepasst, aus fremdem Sein, das ihnen völlig als die eigene Persönlichkeit erscheint. Sie sind in ihrem Wesen im großen und ganzen einheitlich geworden, weil aller fremde Wille, aus welchem sie in Wirklichkeit bestehen, in seinem tiefsten Wesen und seinen letzten Zielen einheitlich gerichtet ist. Sie haben sich das innere Zerrissensein erspart, sie sind in den Dingen, wie sie liegen, angepasst. So sind die allermeisten. Allein wenn auch kein einziger, so wie die Dinge liegen, es vermag, das Aufgedrängte völlig von sich fernzuhalten: es gibt es auch solche, welche auch das Wesenseigene nie ganz verlieren können. Das Schicksal dieser Menschen ist der innere Konflikt des Eigenem und Fremden, die innere Zerrissenheit, das Leiden an sich selbst. Es ist die Menschenart, mit deren unverlierbar führenden Motiven es unvereinbar bleibt, dass sie den ersten großen Kompromiss geschlossen haben.“
Lilo lies das Buch sinken und sah Eva neugierig an.
„Ich widerspreche“, erwiderte Eva sofort. „Ich fühle mich weder zerrissen, noch kann mir irgendjemand einreden, dass ich aus fremdem Willen bestehe.“
„Ja du“, widersprach Lilo leise und zögernd.
„Aber du bist auch ganz anders als deine Eltern“, hielt ihr Eva vor. „Möchtest du dir wirklich nachsagen lassen, du hättest deren Wollen und Wesen übernommen?“
„Bestimmt nicht“, meinte Lilo. „Ich rechne mich eher zu diesen Zerrissenen, die an einem inneren Konflikt leiden.“
„Wieso innerer Konflikt?“, widersprach Eva. „Wenn dich deine Eltern bevormunden oder sonst jemand einen anderen unterdrückt, dann ist das für mich ein äußerer Konflikt. Und überhaupt: Wenn jeder Mensch nur eine Schablone seine Eltern wäre und die wiederum ihrer Eltern und die ihrer, dann hätte es seit Anbeginn der Menschheit keine neuen Gedanken gegeben, was einfach nicht stimmt.“
„Ich weiß nicht“, entgegnete Lilo. „Kommt es dir nicht auch vor, als ob die meisten Menschen sehr einheitlich sind und meist nur das tun, was ihnen andere sagen, eine graue Masse, ohne eigenes Wesen, ohne Willen und Bewusstsein?“
„Ja, schon“, gab Eva zu. „Viele sind wirklich ganz zufrieden damit, nur zu tun und denken, was man ihnen vorgibt. Aber man muss nicht so sein, wenn man nicht will!“
„Aber wenn man seinen eigenen Willen nicht mehr erkennen kann?“, warf Lilo ein. „Weil man schon als Kind gelernt hat, dass man das nicht darf! Weil man bereits als Kind zerstört worden ist!“
„Unsinn“, warf Eva heftig ein. „Lilo, lass dir doch nicht von diesem dummen Buch einreden, dass deine Eltern dich zerstört haben und dir jetzt nichts bleibt als innere Zerrissenheit. Sie können dich nicht daran hindern, wenn du volljährig bist, auf diesen Monte Verità oder zur irgendeiner ähnlichen Gemeinschaft zu gehen, wenn du das immer noch willst.“
Lilo schwieg eine Weile. „Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will“, setzte sie dann an. „Ich glaube, ich tauge nicht dazu. Ich habe dir ja erzählt, dass sie diese Licht-Luft-Bäder nackt nehmen, Männer und Frauen zusammen. Manche laufen sogar nackt herum. Ich finde, die Vorstellung sehr schön, sich so unbefangen und frei und nicht durch irgendwelche Kleidung behindert vollkommen der Sonne und dem Licht auszusetzen. Aber ich glaube nicht, dass ich es je über mich bringen könnte, das selber zu tun. Ich würde mich entsetzlich schämen, obwohl ich überzeugt bin, dass es nichts Falsches ist. Nur, weil meine Eltern es bereits schandbar finden, wenn ein Mädchen mit nackten Beinen badet. Wenn sie wüssten, was Tante Emmi auf dem Monte Verità gemacht hat, würden sie wahrscheinlich sagen, dass jede Hure mehr Anstand hätte“
„Deine Eltern würden nie das Wort Hure in den Mund nehmen“, lästerte Eva. „Allenfalls noch Verworfene.“
„Aber verstehst du mich?“, flehte Lilo. „Würdest du dich überwinden können? Ich meine, nackt vor anderen Menschen zu sein?“
„Ich glaube nicht“, meinte Eva. „Ich verspüre auch keine Lust darauf. Was sorgst du dich deswegen, Lilo? Wenn du es tun möchtest, dann tue es. Wenn du es nicht möchtest, dann tue es nicht. Auch wenn dir irgendwelche Naturapostel erzählen, dass nur das zur kosmischen Erlösung oder sonstigen Quark verhilft.“
Lilo mußte lachen: „Ach, Eva, ich glaube nicht, dass du recht hast, aber du kannst Dinge so einfach darstellen.“
„War es nur das, weswegen es dir so peinlich ist, von dem Buch zu reden?“, hakte Eva unverblümt nach.
Lilo lachte wieder. Sie war nicht mehr nervös: „Nein, da stehen noch Sachen drin ... Ich glaube, es gäbe Leute, die würden tot umfallen, wenn sie das lesen. Pass auf, ich zeige es dir!“
Lilo blätterte wieder in dem Buch: „Hier schau, dir das einmal an!“
Eva überflog den Text: „Es ist nach den Ergebnissen der Anthropologie wohl nicht mehr zweifelhaft, dass die bestehende Familienordnung, die Vaterrechtsfamilie, keine solche ist, die mit der Menschheitsentwicklung von Anbeginn her sich mitentwickelt hätte, dass sie vielmehr das Ergebnis einer Umwälzung vorher bestandener andersartiger Verhältnisse darstellt. Als uranfängliche Institution erkennt die moderne Anthropologie das freie Mutterrecht, das sogenannte Mutterrecht der Urzeithorde. Das Wesen der mutterrechtlichen Institution besteht darin, dass die materielle Vorsorge für die Mutterschaftsmöglichkeiten der Frau von allen Männern der Gesellschaftsgruppe – hier also des ganzen Stammes – gewährleistet wird. Das Mutterrecht gewährt der Frau die wirtschaftliche und damit die sexuelle und menschliche Unabhängigkeit vom einzelnen Mann und stellt die Frau als Mutter in ein Verhältnis der direkten Verantwortlichkeit der Gesellschaft gegenüber, die als die Trägerin des Interesses an der Zukunft eintritt. Die Mythologie aller Völker bewahrt die Erinnerung an den prähistorischen Zustand des freien Mutterrechts in der Idee von einem gerechten goldenen Zeitalter und Paradies der Urzeit. Über den Übergangsvorgang vom alten Mutterrecht zur jetzt bestehenden Familienordnung besteht zur Zeit die sehr plausible Vermutung, dass die bestehende Form der Ehe als sogenannte Raubehe ihren Ursprung genommen hat, dass also die Grundlage der bestehenden Vaterrechtsfamilie aus dem Gebrauch von kriegsgefangenen Sklavinnen hervorgegangen ist. Es wäre damit gesagt, dass die Assoziation der Sexualität mit Vergewaltigungsmotiven, die sexuelle Vergewaltigungssymbolik, welche die Menschheit durchzieht, auf einen universalen sexuellen Vergewaltigungsvorgang als ihre menschheitsumfassende Ätiologie zurückgeht. Sei dem wie immer, auf jeden Fall müssen wir erkennen, dass die bestehende Familienordnung auf den Verzicht auf Freiheit der Frau gestellt ist, und dass diese Tatsache im inneren sexuellen Konflikt, genauer gesagt, in der sexuellen Vergewaltigungs- und Destruktionssymbolik ihren notwendigen psychologischen Ausdruck findet. Das Grundprinzip jeder Gesellschaftsordnung ist die materielle Fürsorge für die Frau zur Ermöglichung der Mutterschaft. In der bestehenden Gesellschaftsordnung, der Ordnung des Vaterrechts, wird die Ermöglichung der Mutterschaft der einzelnen Frau vom einzelnen Manne geboten, und dies bedeutet die materielle und damit die universelle Abhängigkeit der Frau vom Manne um der Mutterschaft willen. Der Trieb zum Muttersein in der Frau ist zweifelloser als irgendein anderer ein angeborener und unveräußerlicher Grundinstinkt, und die bestehende Gesellschaftsordnung erzeugt mit der der Frau gestellten Alternative zwischen dem Verzicht auf das Muttersein und dem Verzicht auf die freie Selbstbetätigung die Gegensatzstellung und Konfliktbildung zwischen den beiden essentiellen Grundinstinkten in der Frau: des spezifisch weiblichen Triebes zum Mutterwerden und des allgemein menschlichen zur Aufrechterhaltung der eigenen unabhängigen Individualität. Es ist nach dem fürher Gesagten selbstverständlich, dass der Konflikt zwischen diesen beiden Endeinstellungen, dieser tiefste innere Konflikt der Frau nur dort erhalten bleibt, wo sich ein unverlierbarer Willen zum Festhalten an der eigenen Individualität und ihrer Freiheit, ein Willen sich nicht vergewaltigen zu lassen, erhalten kann. Das heißt also in den allerwenigsten. Die ungeheure Mehrzahl der Frauen findet ihr inneres Gleichgewicht und ihre innere Einheit in dem Verzicht auf eigene Individualität, in menschlicher wie sexueller Passivität. Allein in allen Frauen erhält sich, sei es bewusst oder unbewusst, sei es mit innerlichem Ja oder Nein, das innere Gefühl, dass sie mit ihrer Sexualität und Mutterschaft sich vergewaltigen lassen: die Vergewaltigungs- und Destruktionssymbolik für Sexualität und Mutterschaft. Gleichwie in allen Männern, sei es bewusst oder unbewusst, sei es mit innerlichem Ja oder Nein, sich unverlierbar ein Gefühl erhält, daß ihre sexuellen Beziehungen zur Frau im Grunde Vergewaltigung sind.“
„Du lieber Himmel! Das ist allerding starker Tobak!“, hauchte Eva ehrfürchtig. „Ich verstehe, dass deine Eltern das nicht zu Gesicht bekommen dürfen. Aber weißt du, was eine menschheitsumfassende Ätiologie ist?“
Lilo schüttelte den Kopf.
„Dass diese Gelehrten sich nicht verständlich ausdrücken können! Aber irgendwie erscheint mir das alles unheimlich! Ich weiß nicht warum! Eigentlich sollte ich Hurra schreien, dass endlich mal jemand die Abhängigkeit der Frauen anerkennt. Stattdessen bekomme ich eine Gänsehaut. Irgendwie geht mir das immer so, wenn Männer meinen, über das innere Wesen der Frau schreiben zu müssen. Ganz gleich, ob sie in der DTZ über deren wunderbare Selbstlosigkeit in Verzückung geraten oder ob dieser Gross hier meint, dass sie sich vergewaltigt fühlen müssen, wenn sie verheiratet sind.“
„Ich finde seine Schlußfolgerungen so beunruhigend“, warf Lilo ein. „Er will jede Art von Heirat und Familie abschaffen. Jede Frau soll Beziehungen zu so vielen Männern wie sie will haben, ihre Kinder aber alleine erziehen und ihren Lebensunterhalt von der Gemeinschaft, dem Staat, erhalten.“
„Ich frage mich, ob dieser Gross redliche Motive hat“, überlegte Eva. „Vielleicht möchte er auch nur einfach zu vielen Frauen Beziehungen haben und sich nicht um die Kinder kümmern, und behauptet deshalb, es wäre das Beste für die Frauen so zu leben.“
„Aber er hat doch recht, wenn er schreibt, dass unsere Gesellschaft auf der Unfreiheit der Frau ruht. Eine unverheiratete Frau kann ihren Lebensunterhalt heute selbst verdienen, aber eine verheiratete mit Kindern ist ganz und gar von ihrem Mann abhängig.“
„Das stimmt natürlich“, gab Eva zu. „Aber er schreibt nichts vom Wahlrecht für Frauen, nichts von Frauenbildung, nichts davon, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Frauen genausoviel Verstand haben wie Männer.“
„Ich denke, dass meint Otto Gross, wenn er von der Aufrechterhaltung der eigenen Individualität spricht“, verteidigte Lilo den Autor ihres Buches.
„Aber ich möchte nicht Kinder bekommen, ohne von einem Mann abhängig zu sein“, widersprach Eva. „Ich möchte Journalistin werden. Ich will, dass man meine Meinung in einer Diskussion genauso ernst nimmt wie die eines Mannes. Dabei hilft es mir kein bisschen, wenn es keine Familien mehr gibt und der Staat Mütter für die Aufzucht ihrer Kinder bezahlt.“
„Möchtest du nicht heiraten und Kinder bekommen, Eva?“, fragte Lilo.
Eva runzelte die Stirn: „Kinder? So etwas wie meinen Bruder, nur dass man sie lieben muss? Ich weiß nicht!“
„Ich denke schon, dass es sehr schön sein kann, Kinder zu glücklichen Menschen zu erziehen, die ein harmonisches und bewußtes Leben leben, in Einklang mit der Natur und den Kräften des Kosmos“, gestand Lilo. „Und einen Mann zu finden, der dieselben Ideale hat und sie zusammen mit mir verwirklicht. Aber davon schreibt Otto Gross gar nichts. Als ob es nicht auch glückliche Ehen geben könnte.“
„Du hast Recht“, stellte Eva fest. „Wahrscheinlich hat er selber kein Interesse daran.“
„Ich glaube nicht, dass ich mit mehreren Männern Beziehungen haben könnte. Ich würde mich zu Tode schämen“ meinte Lilo. „Du?“
Eva schüttelte den Kopf, ging aber nicht weiter auf Lilos Bemerkung ein. Das Gespräch war ihr auf eine zu intime Ebene geraten. Dergleichen vertraute sie höchstens Lea an, aber vieles nicht einmal ihr. „Hat deine Tante etwas zu dem Buch geschrieben?“, fragte sie ablenkend.
„Oja, sie schreibt, dass Otto Gross einer der wundervollsten Menschen sei, die je gelebt hätten. Jeder in ihren Kreisen in München schwärme von ihm. Er habe auf geradezu unheimliche Art in das Innere jedes Menschen blicken können.“
„Ist er denn schon tot?“
„Nein! Aber sein eigener Vater hat ihn entmündigen und in eine Heilanstalt einweisen lassen. Stell dir das einmal vor! Und sogar dieser berühmte Doktor Freud, dessen Schüler Gross einmal gewesen ist, hat sich inzwischen von ihm losgesagt. Aber meine Tante schreibt, in München würden einige Leute nach seinen Theorien leben. Es gäbe da in ihrem neuen Bekanntenkreis eine „Kosmische Runde“, die die wundervollsten und befreiensten Gedanken entwickeln würden und eine Gräfin Reventlov, die schon viele Liebhaber gehabt hat, ihren Sohn aber alleine erzieht und überhaupt eine der bewunderstenwertesten Frauen sei, die es gebe.“
„Reventlov?“, rief Eva elektrisiert. „Bei der Deutschen Tageszeitung schreibt ein Graf Reventlov die schlimmsten, chauvinistischsten Artikel. Stell dir vor, die Frau in München wäre seine Tochter oder Schwester oder Nichte oder auch durchgebrannte Frau? Damit könnte man ihn doch bis ins Mark blamieren.“
Lilo interessierte eine Blamage der Deutschen Tageszeitung und ihres Leitartiklers nicht. „Tante Emmi wohnt jetzt mit einem Mann zusammen, den sie auf dem Monte Verità kennengelernt hat. Sie schreibt, dass Leben in München sei ein einziger dionysischer Rausch und sie fühle sich den Kräften des Kosmos so nahe wie nie zuvor.“
„In München? Das wundert mich, wo sie bisher doch so vom reinen Leben in der Natur geschwärmt hat“, gab Eva zu Bedenken.
Lilo zuckte mit den Schultern. Sie wirkte wieder etwas bekümmert. „Sie hat früher auch geschrieben, dass es das ergreifendste Erlebnis sei, unbekleidet unter lauter Schwestern und Brüder im Geiste zu leben, umgeben von edlem, keuschen Sonnenlicht, das alle irdischen Gelüste vernichtet. Und jetzt schwärmt sie davon, welche Ekstase der leiblichen Wonnen sie erlebe. Es klingt nicht, als würde sie sehr keusch leben.“
Eva unterdrückte eine spöttische Bemerkung. Sie wusste schließlich, wie viel Lilo von ihrer unkonventionellen Tante hielt. Ob sie irgendwann genauso für den dionysischen Rausch und die sexuelle Freiheit schwärmen würde wie jetzt noch für den Vegetarismus und die reine Natur? „Ach, weißt du“, sagte sie laut. „Eigentlich ist im Moment nur wichtig, dass du dich nicht von deinen Eltern zu irgendeiner Heirat nötigen lässt, bevor du volljährig bist und selber über dich bestimmen kannst.“
„Ja, du hast Recht“, pflichtete ihr Lilo inbrünstig bei.
Sonntag, 5. Juli 1914
Im Gegensatz zu vielen anderen Zeitungsverlegern gönnte Arthur Hoffmann sich und seinen Angestellten einen arbeitsfreien Sonntag. Die Leser des Stadtanzeigers mussten sich am Sonntag mit der Vorabendausgabe des Samstags begnügen - der jedoch die nach wie vor beliebte Beilage für alle Sammelfreunde beilag – und erhielten dann erst wieder am frühen Montagabend nach Büroschluss neue Informationen.
Also hatte Familie Hoffmann am Sonntagvormittag gemeinsam einen Gottesdienst besucht und hatte dann ein sommerliches Mittagsmahl bestehend aus Tomatensuppe, Haffzander mit Sauce Colbert und einer kalten Fruchtsuppe als Dessert eingenommen. Danach verzog Eva Charlotte sich mit den Fortsetzungen ihrer Zeitungsromane in einen Liegestuhl auf den Balkon. Der sterbenslangweilige Krimi in der Norddeutschen enttäuschte sie schon wieder. Der verschwundene Kommissar tauchte endlich wieder auf. Seine Geliebte hörte ihn plötzlich pfeifen und – siehe da! – er war die ganze Zeit über in der Nachbarswohnung gefangen gehalten worden. „Die wollen einen wohl für blöd verkaufen“, knurrte Eva und griff zur Kreuzzeitung.
Wenig später tauchte ihr Vater auf, bewaffnet mit einem dicken Zeitungspacken und einer ebenso dicken Zigarre. „Na, wie geht’s deinem Roman?“
„Oh, gut! Die Heldin entflieht gerade einem Freudenhaus.“
„Was?“ Ihr Vater schien ehrlich schockiert. „Und so was bringen die in der Kreuzzeitung?“
„Du kennst die Phantasien alter Militärs nicht, würde Bruno sagen“, gab Eva zurück. „Aber keine Sorge: Selbstverständlich flieht sie rechtzeitig und unangetastet.“
Arthur Hoffmann schüttelte ungläubig den Kopf und widmete sich seinen Zeitungen. Irgendwann verriet ein erstaunter Pfiff, dass er auf etwas Bemerkenswertes gestoßen war.
„Was ist?“, erkundigte seine Tochter sofort.
„Ach es ist nur …“
„Was?“
„Der Pester Lloyd, heißt es hier, erklärt, dass Österreich-Ungarn keinen Krieg mit Serbien möchte, die serbische Regierung aber unverzüglich Maßnahmen gegen die antiösterreichische Propaganda ergreifen müsse.“
„Was ist daran so bemerkenswert?“, gab Eva zurück. „Da gab es aber schon viel schärfere Pressekommentare aus k.u.k.“
„Nun der Pester Lloyd wird gelegentlich für offiziöse Verlautbarungen genutzt. Es könnte sich also durchaus um eine Warnung von Seiten der k.u.k.-Regierung handeln. Die meisten Zeitungen fassen das auch so auf und titeln ‚Eine Warnung an Serbien’.“
„Glaubst du, dass das ernst ist?“, vergewisserte sich Eva alarmiert.
Ihr Vater wirkte nachdenklich, aber nicht zu erregt. „Nun, es soll mit Sicherheit als ernste Drohung aufgefasst werden. Ich denke, man kann es den Österreichern auch nicht verdenken, wenn sie einen gewissen Druck gegenüber Serbien aufbauen wollen, damit dieses endlich Maßnahmen gegen die schlimmsten Auswüchse der antiösterreichischen Agitation unternimmt. Vorstellbar, dass sich da noch was hochschaukelt und vielleicht auch die anderen Mächte wieder als Vermittler eingreifen müssen. Aber ich denke, dass Serbien von sich aus ein paar Maßnahmen ergreifen wird, die wahrscheinlich mehr Alibi-Charakter haben, aber Österreich doch den Wind aus den Segeln nehmen. Wir werden sehen.“
Nachdem sie auch den Roman aus der Kreuzzeitung beendet hatte, nahm sich auch Eva die politische Berichterstattung vor. Doch die bestand vor allem aus wilden Gerüchte und Dementis von Gerüchten, die es noch gar nicht nach Berlin geschafft hatten. Angeblich waren 50 serbische Freischärler, als Türken verkleidet, auf dem Weg nach Bosnien. Aber, nein, dass der serbische Gesandte in Wien ermordet worden war, sei nicht wahr und ebenso wenig träfe es zu, dass den bosnischen Soldaten der übliche Ernteurlaub gestrichen worden sei. Ansonsten gab die DTZ natürlich wieder mal Anlass, sich aufzuregen. „Ein gewisser Paul Baecker führt den messerscharfen Beweis, dass die Sozialdemokratie an dem Attentat schuld war“, verriet Eva ihrem Vater. „Denn der Behauptung, dass die Täter Sozialdemokraten gewesen seien, sei nie wiedersprochen worden. – Außer einmal von der DTZ selbst, wenn ich mich recht erinnere. – Und dann ist es natürlich aussagekräftig, dass die sozialdemokratisch Presse, nicht in die allgemeine Serbenverteufelung eingestimmt hat. Die DTZ scheint deswegen allmählich zu dem Schluß zu kommen, dass der Kampf gegen die Sozialdemokratie doch wichtiger ist als der gegen die Serben. Allerdings bleiben die Serben natürlich auch nicht ungeschoren. Ein Offizier aus Franz Ferdinands Gefolge darf seinen Eindruck schildern, dass in Sarajewo alle – die Beamten, die Polizei, die Popen und die Gemeindevertretung – im Einverständnis mit dem Mord gewesen seien. Beweis Nummer 1: Die Leute waren über den Besuch nicht begeistert, in den Serbenvierteln habe man nicht einmal die Mütze abgenommen, als die Herzogin vorbeifuhr. Beweis Nummer 2: Princip sagte: ‚Ich bin kein gewöhnlicher Mörder! Ich bin ein serbischer Nationalheiliger!’ Beweis Nummer 3: Als die Offiziere ihre Aussage über das Attentat machen mussten, grinste der serbische Schriftführer so, daß ein Offizier ihm sagen mußte, er werde ihm mit dem Säbel über den Kopf hauen, wenn er nicht zu grinsen aufhören wolle. Beweis Nummer 4: Als danach das serbische Kloster von einer wütenden Menge gestürmt wurde und der Pope schoss, wurde er nach seiner Verhaftung gleich wieder freigelassen, unter dem Vorwand in Notwehr gehandelt zu haben. Beweis Nummer 5: Bei dem Popen wurde ein Bild gefunden, das König Peter von Serbien in Wien einreitend zeigt.“
„Evchen“, stöhnte ihr Vater. „Entweder hörst du endlich auf, dich über die DTZ zu echauffieren oder ich verbiete dir ab sofort, sie zu lesen. Sie ist nun mal ein Schmier- und Schundblatt. Da könntest du jeden Tag die Wände hoch gehen.“
Montag, 6. Juli 1914
„Hier, sieh mal, Liebling! Kleid ‚Monika’, ist das nicht hübsch? Waschbarer Crepe, Bastistkragen und Strickkrawatte und nicht mal zehn Mark. Das erscheint mir ein gutes Angebot, nicht?“
Eva warf einen halbherzigen Blick auf die Zeitung, die ihr ihre Mutter hingeschoben hatte: „Ja, ganz nett!“
„Oder wie findest du Modell ‚Doris’? Mit diesen Tupfen, das macht sich doch auch ganz apart. Sie haben bei Israel auch bunten Baumwollmusselin für 25 Pfennige im Angebot. Ich denke, wir sollten da nach dem Essen hinfahren.“
Mit einem Schlag hatte Magda Hoffmann die volle Aufmerksamkeit ihrer Tochter.
„Heute?“, rief Eva entsetzt. „Bei diesem Wetter?“ Es war nicht mehr ganz so heiß wie die vergangenen Tage, dafür aber drückend schwül geworden. "Und außerdem hat bei Tietz der Ausverkauf erst am Samstag angefangen." Und ohne einen Besuch im Einkaufspalast von Hermann Tietz, das wusste sie, war für eine Mutter eine solche Unternehmung undenkbar. "Und bei Israel soll es schon zu den schlimmsten Szenen gekommen sein, habe ich gehört."
„Ein Grund mehr, sich zu beeilen, bevor es nichts mehr von Interesse gibt“, erklärte ihre Mutter unerschütterlich.
„Bitte, Mama“, flehte Eva. „Es hat doch keine Eile. Ich habe auch noch genug zum Anziehen. Wirklich!“
Doch sind fand kein Gehör. „Eva, ich habe wirklich keine Lust auf diese Anstellerei. Entweder wirst du heute Nachmittag mit Einkaufen gehen und dich dabei benehmen oder ich werde deinen Vater bitten müssen, dass diese ständigen Redaktionsbesuche ein Ende haben.“
Die Drohung war ernst, das wusste Eva Charlotte. Ihr Vater ließ ihr zwar viel durchgehen, aber ihre Mutter ärgerlich machen, das ging gar nicht.
Zu allem Überfluss bestand ihre Mutter auch noch darauf, den kleinen Bruder mit zu nehmen. Und natürlich war es bei Israel in der Spandauer Straße genau so voll und stickig wie befürchtet. Es dauerte auch, bis sich Eva und ihre Mutter auf ein Kleid und zwei Blusen einigen konnten. Denn obwohl Eva Charlotte Hoffmann eifrig ihr Selbstbild als vernünftiger, modischem Firlefanz abholder Wandervogel pflegte, hatte sie äußert genaue Vorstellungen, was „altbacken“, „zopfig“, „albern“, „zierpuppenhaft“ oder – am allerschlimmsten! – unkomfortabel war und deshalb auf gar keinen Fall getragen werden konnte. Dabei kam ihr die aktuelle Mode sogar entgegen. Die setzte immer mehr auf elegante Silhoutten, denn üppigen Zierrat, und Eva war groß und schlank genug, um schmale Röcke und schlichte Blusen auch ohne Bauch-weg-Korsett tragen zu können.
Auch Alfie wäre gern mit der Mode gegangen. Kaum hatten sie die Kinderabteilung betreten, erscholl sein gefürchteter Ruf „Trosenanzug!“
Er wünschte sich seit längerem unbedingt einen Matrosenanzug. Alle seine Freunde trugen einen. Leider hatte er einen Vater, der Matrosenanzüge als ein Bekenntnis zur kaiserlichen Flottenpolitik verstand. Und da er die nun mal strikt ablehnte, durften seine Kinder keine Matrosenkleidung tragen. Schluss! Aus! Auch Eva, die jenseits aller politischen Ansichten, Matrosenblusen einfach flott fand, war schon auf Granit gebissen.
Nachdem es endlich gelungen war, Alfie einen anderen Anzug schmackhaft zu machen, ein Besuch im Kaufhaus Tietz zu einem weitern Kleid für Eva geführt hatte und auch alle anderen Besorgungen erledigt waren, die Magda Hoffmann für nötig hielt, bot diese ihrer Tochter als Versöhnung einen Konditorei-Besuch an. Eva betrachtete ihre bereits ermattete Mutter, den quengelnden Bruder, die vielen Tüten, entschied, dass ein solches Unterfangen mit weiteren Strapazen verbunden sein würde, die sich auch für einen Eisbecher nicht lohnten, und erbat sich lieber die Erlaubnis in der Redaktion vorbeizuschauen.
Dort herrschte rege Betriebsamkeit.
„Keine gute Zeit für eine kleine politische Plauderei“, wurde sie von Bruno informiert. „Die anderen arbeiten und ich denke nach.“
„Schade“, meinte Eva und ließ sich auf einen Stuhl fallen.
Bruno musterte sie kritisch. „Sie sehen mitgenommen aus.“
Eva stöhnte: „Sieht man mir das auch noch an? Ich wurde in den Ausverkauf geschleppt.“
Ihr Gegenüber grinste und griff nach seinem Bleistift. „Der Krieg hat begonnen“, dozierte er, während er schrieb. „Seine Schauplätze heißen Wertheim, Tietz und Israel, Jandorf und Gerson. Bereits im frühen Morgengrauen drängen sich mit Regenschirmen und Einkaufstaschen bewaffnete Scharen vor den Toren, die dann alsbald erstürmt werden. Schlachtrufe sind zu hören. ‚Auf zu den Miederwaren’ erklingt es hier. ‚Blusen, Blusen’ ruft man dort. – Was noch, Fräulein Hoffmann? Machen Sie einen Vorschlag!“
„Kinderschürzen, Vorhangstoffe, Hüte ...“
„Nehmen wir die Kinderschürzen. Aber weiter: Doch hier gibt es keine Koalitionen. Jeder kämpft gegen jeden. ‚Hände weg, das ist meine Bluse’, tönt es und …“
„Her mit dem Schlüpper, Frollein“, schlug Eva vor.
Bruno bekam einen Lachanfall. „Im Ernst, Fräulein Hoffmann? Ein wenig Anzüglichkeit ist wunderbar. Aber wir müssen realistisch bleiben. Wenn die Leute sich nicht erkannt fühlen, wirkt es nicht.“
„Das habe ich heute mit eigenen Ohren gehört“, versicherte Eva.
„Gut“, meinte Bruno und fuhr fort. „Teilweise werden allerdings Kinder und Hauspersonal als Hilfstruppen mitgenommen. – Stimmt das?“, vergewisserte er sich.
Eva nickte. „Da war so ein alter Drache, die hat sich wirklich wie ein General aufgeführt. Ich glaube, es war ihre Schwiegertochter, die sie rumkommandiert hat: ‚Schau nach dem, schau nach jenem. Sei doch nicht so langsam! Mein Gott, wie ungeschickt.’“
„Auch abhängige Verwandte werden gerne herangezogen“, fuhr Bruno fort. „Manche würdige Matrone kommandiert eine kleine Armee, lässt sie taktische Manöver aufführen: ‚Alle nach rechts! Zu den Hüten! Haltet Ausschau nach schwarzen Strümpfen! Schneller, schneller! Nicht, so zimperlich! Pardon wird nicht gegeben!’ Schon gibt es erste Opfer. – Irgendwelche Ideen, Fräulein Hoffmann?“
Eva dachte nach. „Kleine Kinder. Die werden natürlich ständig angestoßen und gequetscht und schreien dann wie verrückt. Und natürlich kann es passieren, dass mal was zerreißt, wenn an beiden Seiten daran gezogen wird. Battist zum Beispiel oder Spitze. Und Einkaufstaschen fallen herunter. Sie sollten auch unbedingt etwas darüber schreiben, dass sich die Leute um die verrücktesten Dinge schlagen, solche, die nächstes Jahr garantiert außer Mode sind. Und was über Korsetts. Irgendwas Böses über Korsetts.“
„In Ordnung“, stimmte Bruno zu und fuhr fort: „Der Kampf um die Beute wird erbarmungslos geführt. Manche Matrone legt sogar Rüstung an. Denn während die jungen Mädchen mehr und mehr dazu übergehen, ihre reizenden Formen mit losen Reformkleidern zu verschleiern, pflegt die anständige Dame Büste und Taille immer noch von beinharten Korsetts aufs Schönste modelliert zur Schau zu stellen. Blut fließt Gott sei Dank nur selten. Aber hier und da ist das Zerreißen von zartem Blusenstoff zu hören. Dort fallen Taschen. Ihr Inhalt ergießt sich über den Boden, unzählige Füße trampeln über eben gemachte Beute, aber auch über Tomaten und Mehltüten hinweg. Selbst der eigene Nachwuchs, sonst sorgsam behütet, wird dem erbarmungslosen Drängen und Treiben schutzlos anheim gegeben. Das Geschrei, das unsere Einkaufstempel derzeit durchdringt, ist markerschütternd und sollte, so möchte man meinen, das härteste Gemüt erschüttern. Aber es geht ja um so viel … - So, jetzt sind wieder sie dran: Was ist nächstes Jahr unter Garantie aus der Mode?“
„Puh“, machte Eva. „Was Mode betrifft, bin ich wirklich kein Experte. Ich denke, dass Rüschen und Spitzen und üppiger Besatz immer gründlicher aus der Mode kommen werden. Stehkragen kann man eigentlich schon heute nicht mehr tragen. Und diese matronenhaften, ausladenden Hüte, vor allem die, die mit ganzen ausgestopften Vögeln garniert sind …“
„Gibt es so was?“
„Haben sie noch keine gesehen?“
„Ich pflege Damen nicht auf den Hut zu schauen.“
Eva unterließ die Nachfrage, wohin Bruno sonst sah. Sie gab sich nicht der Illusion hin, dass er in dieser Hinsicht besonders anständig war. „Es gibt sie“, versicherte sie stattdessen auf die Hüte bezogen. „Neulich habe ich einen gesehen mit sechs ausgestopften Küken. Sie haben sogar noch dafür geworben, das echte Kadaver verwendet wurden.“
Bruno antwortete mit einem Kopfschütteln. „Ich werde daran denken, wenn man uns das nächste Mal weiß machen will, die Damenwelt wäre empfindsam.“ Er brachte seinen Artikel zu Ende, änderte ein paar Kleinigkeiten und gab ihn Eva dann noch einmal zu lesen: „Gefällt er Ihnen, Fräulein Hoffmann?“
„Herrlich“, schwärmte Eva. „Ich beginne zu begreifen, dass dieser Ausverkauf ein großes Abenteuer gewesen ist, das versäumt zu haben, unbedingt schade gewesen wäre.“
Inzwischen war auch ihr Vater herübergekommen. „Was treibt ihr beiden da?“
„Sie haben sich doch was Humoristisches gewünscht“, beschied Bruno seinem Arbeitgeber und reichte ihm seine Notizen.
Arthur Hoffmann brach sehr schnell in schallendes Gelächter aus. „Sehr schön, sehr schön. Aber die Propaganda meiner Tochter für unkleidsame Reformkleider wollen wir doch lieber herausnehmen. Und auch, wenn wir das Tragen von Korsetts in die Nähe des Unanständigen rücken, machen wir uns keine Freunde.“
Bruno unterdrückte nur zu deutlich die Bemerkung, dass er nicht vorhatte, sich mit seiner Schreiberei Freunde zu machen, dafür aber mit Wonne Feinde.
„Streichen wir diesen Satz“, meinte sein Arbeitgeber aber. „Der Rest … Sehr schön!“
„Dafür habe ich was gut“, forderte Eva, als ihr Vater wieder verschwunden war.
„Zugegeben“, räumte Bruno ein. „Was wünschen Sie?“
„Sie vergessen die Sache mit der Internationale.“
Einen Augenblick sah es aus, als wolle Bruno sie der Feigheit zeihen, dann aber meinte er: „Wie Sie wünschen!“
Etwas später kam Paul Zimmermann: „Würden Sie vielleicht so freundlich sein, Fräulein Hoffmann, und diesem Artikel lesen und mir sagen, was Sie davon halten?“
Eva sagte bereitwillig zu, wunderte sich aber mit jeder Zeile mehr über Pauls Ansinnen. Die Zeitung war mal wieder die DTZ und der Autor behauptete, den Beweis zu führen, dass die Serben in Bosnien nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil bevorzugt würden. Aber im Grunde war das Ganze wieder nur ein Kübel an Widerwärtigkeiten. Was wollte Paul nur damit? Vielleicht war das Ganze noch ein Stück hetzerischer als das, was die DTZ schon die ganze Zeit gedruckt hatte, aber es war weder neu, noch konnte Paul ernsthaft erwarten, dass sie sich von den vorgebrachten Zahlen überzeugen ließ. Überhaupt die Zahlen …
„Also, es tut mir leid“, erklärte sie mit mühsam gezügeltem Ärger. „Aber diese Zahlen beweisen keine Bevorzugung der Serben, eher das Gegenteil.“
„Um was geht es?“, mischte ihr Vater ein.
„Fritz Bley, DTZ“, erwiderte Paul. „Und er untermauert darin eine angebliche Bevorzugung der Serben in Bosnien mit Zahlen, die, wie ihre Tochter ganz richtig bemerkt hat, eher einer Benachteiligung das Wort reden.“
„Bley“, Bruno spuckte den Namen fast aus. „Was erwartet ihr? Kolonial-Apostel, Alldeutscher Verband, Wehrverein, Verband gegen die Überhebung des Judentums, Werdandibund zur Wiederbelebung des germanischen Erbes in der Kunst ...“
„Aber warum bringt er Zahlen, die seine Thesen widerlegen?“, warf Paul ein. „Das merken die Leser doch.“
„Unsinn“, widersprach Bruno. „Wer liest schon Zahlen?“
„Aber …“
„Ja, Fräulein Hoffmann hat es gemerkt. Richtig! Aber erstens besitzt sie Verstand, was ich dem normalen DTZ-Leser nicht zubilligen möchte, und zweitens – was noch wichtiger ist – steht sie in entschiedener Gegnerschaft zur DTZ und der Serbenhetze, die sie betreibt. Ich wette, Fräulein Hoffmann hat diesen Artikel vom ersten Wort an mit der unbedingten Absicht gelesen, ihn zu widerlegen. Der normale Leser aber glaubt seinem Leib- und Magenblatt. Und darum werden alle DTZ-Leser schwören, dass die Zahlen genau das aussagen, was über dem Artikel steht. Nämlich, dass die angebliche Unterdrückung der Serben in Bosnien eine freche Lüge ist. Und wenn Bley so schreibt, wie man Bley kennt …“
„Tut er“, bestätigte Paul.
„… dann werden seine Leser am Ende des Artikels alle Schaum vor dem Mund haben und gegen die Serben und die Russen und die ganze slawische Rasse toben und Zeterundmordio schreien, dass unsere schwache und unfähige Regierung nicht endlich kräftige Schritte unternimmt, unsere hehre germanische Kultur gegen diese Barbaren zu verteidigen.“
„Bruno, Bruno“, meine Arthur Hoffmann kopfschüttelnd. „Sie haben wirklich eine erbärmliche Meinung von der menschlichen Rasse.“
„Niemand, der die DTZ liest, kann die Deutschen für ein Kulturvolk halten“, gab Bruno zurück.
„Solche Blätter gibt es woanders auch“, warf Paul ein. „Das serbische ‚Balcane’ ist genauso so schlimm. Mindestens!“
„Stimmt haargenau“, gab Bruno zu. „Und in jedem anderen Land findet sich Ähnliches. Woraus sich schließen lässt, dass unser werter Herr Verleger vollkommen Recht hat. Ich habe wirklich eine erbärmliche Meinung von der menschlichen Rasse.“
Dienstag, der 7. Juli 1914
Eva saß noch beim Frühstück, als Lore ihre Freundin Lea hereinführte.
„Heil, Wanderschwester“, grüßte Lea und ließ sich auf einen Stuhl fallen. „Hast du Lust, mit mir heute in den Krieg zu ziehen?“
Eva brauchte eine Weile, bis sie verstand, dass die Freundin auf Brunos Humoreske anspielte. Denn normalerweise las man im Hause Goldberg natürlich das renommierte Tageblatt, nicht den Hoffmannschen Stadtanzeiger.
„Hat dieser tapfere Mensch tatsächlich leibhaftig den Kämpfen in der Miederwarenabteilung beigewohnt?“, hakte Lea nach.
Eva berichtete, wie der Artikel wirklich zustande gekommen war und ihre Freundin ließ ein vielsagendes „So, so“ hören. „Dann warst du also schon im Ausverkauf“, schob sie nach. „Schade! Ich hoffte, ich könnte auf deine Unterstützung zählen.“
„Wobei?“
„Es waren am Schabbes mal wieder Tanten zu Besuch, väterlicherseits, was schlimmer ist. Denn während Mütterchen ihrer eigenen Mischpoke gegenüber über eine recht gesunde Kritikfähigkeit verfügt, lässt sie sich von der väterlichen Sippschaft mit schöner Regelmäßigkeit ins Bockshorn jagen und sieht sich als miserabelige Schwiegertochter, die ihre Töchter nicht angemessen verheiraten konnte, unrühmlich in die Annalen der Familie Goldberg eingehen.“
„Aha“, meinte Eva. „Das mal wieder!“ Leas Schwester Recha war an einen Mann geraten, der bankrott gemacht hatte. Und die andere, Chaia, hatte ihren Gatten vor zwei Jahren durch einen Droschkenunfall verloren. Seitdem war Chaia in Trauer versunken und bekam hysterische Anwandlungen, wenn ihre Umgebung so taktlos war, das Thema Wiederverheiratung anzuschneiden. Unglücklicherweise waren die Tanten der Goldbergs sowohl für ihre Vielzahl wie ihre Taktlosigkeit berühmt.
„Das mal wieder“, bestätigte Lea. „Sie haben meiner Mutter die Hölle heiß gemacht, ihr erklärt, wenn ich nicht endlich mit dieser unweiblichen Wanderei aufhören würde, bekäme ich nicht mal mehr einen galizischen Viehjuden ab und überhaupt fehle mir viel, um ein halbwegs gefälliges, weibliches Wesen abzugeben.“
Eva konnte nur grinsen: „Schon ein wenig sehschwach die Tanten, was?“ Denn ihre Freundin war unbestreitbar hübsch. Zierlich wirkend, ohne klein zu sein, mit brünetten Locken und einem reizvollen Gesicht.
„Vor allem überzeugte Anhängerinnen der Moden des letzten Jahrhunderts“, gab Lea zurück. „Sie meinen, junge Männer würden sich immer noch für saftlos-sanfte Wesen mit hilflosem Blick und perfektem Klavieranschlag begeistern, und wer dem nicht entspreche, bleibe sitzen. Dass inzwischen ein frisches und sportliches Auftreten in Mode ist, ist ihnen entgangen.“
„Zum Thema Sitzenbleiben habe ich doch gerade was Schönes in der Zeitung gelesen. Wo war es noch mal? Hier! Eine Heiratsannounce. Sieh dir diese Überschrift an! ‚Schicksal füge es!’. Wenn das kein Hilferuf ist!“
„’23 Jahre, groß, schöne Erscheinung“, las Lea, „aus sehr religiöser Familie, ur-musikalisch, feinfühlige Natur, edler Charakter, später elterliches Vermögen von 300.000 Mark.’ Das muss gelogen sein! Wer so perfekt ist, gibt keine Announce auf! Aber … Handelt es sich eigentlich um einen Mann oder eine Frau? Das steht nirgends.“
„Männer müssen keine Mitgift angeben“, kommentierte Eva trocken und ihre Freundin gab ihr Recht.
„Schade eigentlich! Wenn es ein Mann gewesen wäre, hätte man ja mal antworten können. Aber, was ich eigentlich sagen wollte: Seit diesem Tantenbesuch weist meine liebe Frau Mama unangenehme Anzeichen von Panik auf und zweifelt mal wieder daran, dass es wirklich so ganz ohne Korsett gehen kann und ob nicht ein wenig mehr Eleganz hier und ein wenig mehr Besatz dort angemessen wären. Du verstehst?“
Eva nickte.
„Sieht er eigentlich gut aus?“, fragte ihre Freundin.
„Was? Wer?“
„Na, der junge Mann, dem du hilfst, Artikel zu schreiben. Oder ist er nicht jung?“
„Doch er ist jung. Aber nein, er sieht nicht gut aus“, beeilte sich Eva falsche Gedanken im Keim zu ersticken. „Er sieht sogar ganz entschieden hässlich aus. Abstehende Ohren, schiefe Gesichtszüge, struppiges Haar, das wild in alle Richtungen steht. Er legt auch erkennbar keinen Wert auf gutes Aussehen.“
„Der Künstlertyp also“, urteilte Lea. „Sonst irgendwelche anziehenden Männer in der Redaktion?“
Eva schüttelte den Kopf. „Theo könnte gut aussehen, wenn er sein selbstgefälliges Grinsen ablegen würde. Was er aber höchst selten tut. Und Paul: Nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht dünn, nicht schön, nicht hässlich.“
„Oje! Klingt abgrundtief langweilig.“
„Man muss ihm zugute halten, dass er ein netter Mensch ist. Aber ganz schrecklich korrekt.“
„Und der mit dem Ausverkauf? Scheint zumindest Humor zu haben. Oder hat er sich nur deinen geborgt?“
Eva schüttelte den Kopf. „Du solltest wirklich öfters den Stadtanzeiger lesen. Seine Theaterkritiken sind manchmal Stadtgespräch.“
„Trotzdem höre ich Zögern in deiner Stimme. Ist er nicht nett? Oder stört dich, dass er hässlich ist?“
„Nein, nein! Aber …“ Bruno gerecht zu werden, war wirklich schwer. „Er ist nicht nett. Nicht wirklich. Er möchte es auch nicht sein. Ich vermute, dass ‚nett’ für ihn eher zu den Schimpfworten gehört und er es keinesfalls auf sich bezogen wissen möchte.“
„Aber du magst ihn“, stellte Lea fest.
Eva machte eine zustimmende Geste. „Schon. Ich mag seinen Scharfsinn und seinen Witz, auch wenn es oft ein böser Witz ist. Weit böser als diese harmlose Geschichte mit dem Ausverkauf.“
„Mag er dich auch?“
„Ich denke, ich genieße sein Wohlwollen. Als Anhängerin seines Witzes. Aber ich glaube, er ist ein Mensch, der eine tiefsitzende Abscheu vor den kleinsten sentimentalen Regungen hat.“
„Hm, das ist auch nicht gut“, urteilte Lea. „Irgendwelche Frechheiten?“
„Ganz und gar nicht! Frech, das ist Theo. Er versucht dauernd, mich zu provizieren, nennt mich Evalotte …“
Ihre Freundin brach in Gelächter aus. „Evalotte und dazu ein selbstgefälliges Grinsen! Nein, das geht natürlich gar nicht! Ich werde dich nie wieder nach ihm fragen! Aber der Humorist?“
„Fräulein Hoffmann. Wie Paul auch. Aber der ist, wie erwähnt, äußerst korrekt. Wenn Bruno dagegen so förmlich ist, dann mit Sicherheit, weil er es so und nicht anders möchte.“
„Es ist wirklich zu Schade“, befand Lea. „Der Schöne ein alberner Laffe, der Nette langweilig und der Amüsante in solcher Angst vor Vertraulichkeiten gefangen, dass das Nennen eines Vornamens schon zu den sentimentalen Regungen zählt. Warum können Männer nicht perfekt sein?“
Eva musste lachen. „So gut aussehend wie Theo, so nett wie Paul und so amüsant wie Bruno. Da könnte ich allerdings schwach werden!“
„Nun ja“, meinte ihre Freundin. „Wir sind auch nicht perfekt.“
„Das ist etwas anderes“, protestierte Eva entschieden. „Männer sind nicht von uns abhängig. Wenn wir ihnen nicht gefallen, können sie sich scheiden lassen. Oder eine Geliebte nehmen. Oder ganz in ihrem Beruf oder ihren Liebhabereien aufgehen. Aber all diese Möglichkeiten haben wir armen Frauenzimmer nicht. Also kommen für uns nur perfekte Männer in Frage. Das ist doch klar, oder?“
„Du hast Recht“, stimmte Lea noch kurzem Überlegen zu. „Du hast vollkommen Recht. Aber die Tanten tun, als wäre weiblich Perfektion eine Garantie für männliche Tugend. Als Recha damals heiratete, waren alle voll des Lobes ob der guten Partie. Nun, da – was niemand ahnen konnte – der Auserwählte das ererbte väterliche Bankhäuschen durch allzu hochfliegende Pläne ruiniert hat, ermahnen sie mich ständig, mich vorzusehen, dass es mir nicht wie meiner Schwester gehe und tun so, als wären ein makelloses Klavierspiel, herausragende Stickkünste und zumindest ein „ganz leichtes“ Korsett eine Versicherung gegen männliche Verschwendungssucht.“
„Anstatt Skepsis und Urteilsvermögen zu fördern“, kommentierte Eva.
„Eve!“ Ihre Freunde mimte höchste Entrüstung. „Also diese Kritisiererei gegenüber jungen Männern geht ja wohl gar nicht!“
„Aber auf den Falschen reinfallen auch nicht.“
„In anständigen Familien obliegt – wie du wissen solltest – die Prüfung der Bewerber den Vätern.“
„Also ist dein Vater an Rechas Unglück Schuld?“
Lea schüttelte mit gespielter Missbilligung den Kopf. „Liebste Eva, weißt du wirklich nicht, dass Männer niemals schuld an etwas sind? Und falls doch, dann übergeht die taktvolle Frau das mit Schweigen. Wenn meine Eltern dich so reden hören würden … Sie würden mir glatt den Umgang mit dir verbieten!“
„So schlimm sind deine Eltern auch nicht!“
Lea zog eine Grimasse. „Nein! Aber wenn ich Mütterchen noch länger warten lasse, wird sie wirklich miesepetrig. Und dass, wo du mir deinen Beistand verweigerst!“
„Tue ich doch gar nicht!“
„Du willst dir tatsächlich einen zweiten Ausverkauf antun?“
„Oh, warum nicht!“, gab Eva zurück. Immerhin gab ihr das Ganze einen guten Grund gegenüber ihrer Mutter, in die Stadt zu fahren, und das Fahrgeld sparte sie auch noch.
Die Zustände in den Kaufhäusern waren natürlich kein bisschen beschaulicher als am Vortag. Eva bedauerte glatt, dass Brunos Text schon erschienen war. An allen Ecken und Enden entdeckte sie Dinge, die noch hätten ins Lächerliche gezogen werden können. Sie teilte sie wenigstens Lea mit und dann prusteten sie zusammen los.
„Ihr seid wirklich zwei Gänse heute, ihr beiden“, bemerkte deren Mutter kopfschüttelnd. Entgegen Leas Befürchtungen unternahm sie jedoch keinerlei Versuche, ihrer Tochter die leichte, nicht einengende Reformunterwäsche auszureden. „Ihr seid ja jung. Ihr könnt das tragen“, war ihr Kommentar. Die Rocklänge dagegen war ein schwierigeres Thema.
„Knöchelfrei ist heute wirklich allgemein akzeptiert“, versuchte Eva ihre Freundin zu unterstützen.
„Was es aber noch lange nicht elegant macht“, gab Mila Goldberg mit gelindem Sarkasmus zurück. „Und ich rede auch nur davon, dass mein Fräulein Tochter nach einem halben Dutzend knöchelfreien Röcken vielleicht mal wieder einen oder zwei längere akzeptiert.“
„Wenn man schöne Knöchel hat, sehen auch kürzere Röcke gut aus“, versuchte es Lea.
„Wenn man schöne Schuhe hat, meinst du wohl“, hielt ihre Mutter dagegen. „Aber da hast du ja auch höchst eigene Vorstellungen.“
„Ich habe nichts gegen kleidsame Schuhe“, korrigierte Lea. „Aber Schuhe sind etwas, um damit zu laufen, nicht um dekorativ herzumzustehen.“
Als schließlich alle Kämpfe erfolgreich ausgefochten waren, verabschiedete sich Eva, um in der Redaktion vorbei zu schauen. Doch dort herrschte Alltagsbetrieb. Arthur Hoffmann hatte Theo zu einer unzureichend gesicherten Baugrube an der Kreuzung Invaliden- und Chausseestraße geschickt und ihm den Auftrag gegeben, dies zu einer größeren Geschichte über die gefährlichen Verkehrszustände rund um Baustellen zu machen, die schon zu einigen tödlichen Unfällen geführt hatten. Er selber und Paul beschäftigten sich mit den Nachwahlen in Coburg, wo der nationalliberale Abgeordnete sein Mandat aufgegeben hatte, um Landrat zu werden. „Ich fürchte die Nationalliberalen und die Fortschrittlichen befehden sich so sehr, dass am Ende die Sozis der lachende Dritte sein werden“, orakelte der Verleger missmutig. „Nicht mal ein Stichwahlabkommen haben sie geschlossen.“
Mit seiner Tochter hatte Arthur Hoffmann nicht gerechnet, fand aber einige Schreibarbeiten für sie. So verbrachte Eva einen relativ langweiligen und äußerst ruhigen Nachmittag. Von den beiden Krisenherden, Albanien und Bosnien, gab es keine nennenswerten Neuigkeiten. Die telegraphischen Nachrichten verrieten, dass einige österreichische Minister Audienzen bei Kaiser Franz Josef gehabt hätten, der österreichische Ministerrat aber keinen Schritt gegen Serbien plane.
Der Aufreger des Tages waren Pressemeldungen aus Dänemark, die den Mord an Erzherzog Franz Ferdinand mit Parolen wie ‚Die Kugeln trafen richtig’ und ‚Es liegt ein großer, edler Gedanke in diesem Doppelmord!’ feierten.
Der alte Johannsen schüttelte nur ungläubig den Kopf und Paul äußerte mit allen Anzeichen des Abscheus: „Das ist wirklich ungeheuerlich! Soweit sind nicht einmal die radikalen serbischen Blätter gegangen.“
Auch Eva verstand das Ganze nicht. „Warum tun die Dänen so was?“
„Dänemark ist klein. Ab und zu haben sie wohl das Bedürfnis, auf sich aufmerksam zu machen“, erwiderte Bruno trocken. „Und was eignet sich besser als eine hübsche, kleine Provokation?“
„Das ist mehr als eine Provokation. Das ist hochgradig geschmacklos“, urteilte Paul erregt.
„Interessant an der Geschichte ist“, fiel Arthur Hoffmann ein, „dass die DTZ schreibt: ‚Was selbst serbische Blätter nicht gewagt, das ist diesen Dänischen vorbehalten: Verherrlichung und Rechfertigung’. Dabei haben sie selber die vergangenen Tage Serben, Sozialisten, Liberale usw. wegen angeblicher Verherrlichung des Attentats auf Schärfste gegeißelt.“
„Nur wird den DTZ-Lesern dieser Widerspruch genauso wenig auffallen wie die falschen Zahlen von gestern“, bemerkte Eva, was ihr beifälliges Gelächter der ganzen Redaktion einbrachte.
Da die Nachrichtenagenturen den ganzen Tag über keine interessanten Neuigkeiten geliefert hatten, versprach sich Eva auch vom gemeinsamen Studium der Abendzeitungen wenig und verabschiedete sich nach Beendigung ihrer Arbeit. Sie lief die drei Treppen hinunter, durch die Pforte – und hätte fast wenig damenhaft geflucht. Draußen regnete es. Etwas, womit sie nach all den heißen Tagen überhaupt nicht gerechnet und sich weder mit Mantel noch Schirm bewaffnet hatte. Unschlüssig überlegte sie, ob sie wieder hinauf gehen sollte, als sie eine Straßenbahn kommen sah. Zwar die 45, nicht die 50, die sie nach Charlottenburg bringen würde. Aber egal, dann würde sie eben in der Gitschiner Straße in die Hochbahn wechseln! Sie setzte zum schnellen Spurt über den Moritzplatz an. Doch sie war nicht die einzige. Zur gleichen Zeit stürmte aus den Pforten des Kaufhauses Wertheim eine kleine Armada von Ausverkaufsbesuchern auf das rettende Gefährt zu. Und deren Weg war kürzer. Als Eva den Straßenbahnwagen erreicht hatte, knäulten sich bereits schwer beladene Massen um die Einstiege. Alles drängte und schubste, um sich und seine Beute möglichst schnell ins Trockene zu bringen, was natürlich nur zur Folge hatte, dass sich all die Taschen und Päckchen aus dem Ausverkauf ineinander verkeilten und den Einstieg erst recht behinderten. Die Stimmung war im Nu am Kochen:
„Jetzt macht aba ma hinne!“
„Zu blöde zum Einsteigen, wa?“
„Heh, Sie, drängeln Sie nicht so! Ich war eher da!“
Einer Frau, die schon die Stufen des Einstiegs erklommen hatte, wurde ein Päckchen entrissen und verschwand kullernd zwischen den vielen nachrückenden Beinen. Sie kreischte auf, wollte umkehren, es zu retten, wurde aber weitergeschoben, kreischte noch hysterischer und begann blindwütig mit ihrem Schirm auf die Schiebenden einzustechen. Doch der Straßenbahnschaffner entwand ihr die Waffe mit entschlossenem Griff und zog die Widerstrebende auf die Plattform. Ihr Protest ging im kollektiven Aufschrei der drängelnden Menge unter, denn just in diesem Augenblick, wurde der Regen zum heftigen Wolkenbruch, was den Kampf um den Einstieg in die Straßenbahn noch erbitterter machte. Auch Eva scheute sich nicht Schultern und Ellenbogen einzusetzen. Doch just in dem Moment, in dem sie die Haltestange neben den Stufen zu fassen bekam, begann der Schaffner oben auf der Plattform weiteren Zustrom rüde abzuwehren und das Absperrgitter zuzuziehen. Natürlich erscholl prompt ein Aufschrei der Empörung. Einige versuchten tatsächlich mit beträchtlicher Gewalt noch einen Hand an die Haltestange oder einen Fuß auf die Einstiegsstufen zu bekommen. Eva wurde äußerst rüde zur Seite gestoßen, verspürte einen kurzen Impuls, sich zur Wehr zu setzen, ließ dann aber los. Denn ein kurzer Blick auf den Straßenbahnwagen verriet, dass Wagen und Plattform tatsächlich bis aufs Äußerste voll gestopft waren. Ein weiterer Kampf war sinnlos.
Sie sah sich um. Der ganze Moritzplatz hatte sich inzwischen in einen See verwandelt. Von den Gleisen der Straßenbahn war kaum noch etwas zu sehen. Dafür entschwand die eben verpasste Bahn nicht im nassen Grau, sondern war schon nach wenigen Metern Fahrt wieder stehen geblieben. Offensichtlich sah der Fahrer eine Weiterfahrt unter diesen Bedingungen als zu riskant an. Unter denjenigen, die auf der Plattform nur äußerst unzureichend gegen den seitlich heranpeitschenden Regen geschützt waren, begann sich Unruhe auszubreiten. Einige schienen wieder absteigen zu wollen, doch der Schaffner hielt offenbar erbarmungslos an seinen Vorschriften fest, auf freier Strecke die Gitter geschlossen zu halten. Bei den Zurückgebliebenen begann sich Schadenfreude breit zu machen.
Aber was nun? Evas dünne Bluse und ihr heller Sommerrock waren so nass, als wäre sie damit in die Badewanne gestiegen und auch ihr Hut – mit modisch schmaler Krempe – bot kaum Schutz. Noch immer prasselte der Regen mit unverminderter Vehemenz, aber nasser als sie war, konnte sie unmöglich noch werden. Sie sah sich nach einer Droschke um, doch es war keine zu erblicken, nur zwei Rollkutscher, die Mühe hatten, ihre Pferde unter Kontrolle zu halten. Die schweren Zugtiere gebärdeten sich ob des Regens nervös wie die empfindsamsten Rennpferde. Auch von einem Omnibus, der – da nicht auf Schienen angewiesen – womöglich dem Wasser besser trotzte als die Straßenbahn, war weit und breit nichts zu sehen. Eva beschloss, es mit der Hochbahn zu versuchen.
Also ging, oder besser: watete sie vorbei an weiteren stehenden Straßenbahnhzügen runter zur Gitschiner Straße. Dort schoss das Wasser in so dichten Schwaden vom Viadukt der Hochbahn, dass man unmöglich hindurch zur anderen Straßenseite sehen konnte. Eva beeilte sich in das Haus 71 zu kommen, von dem aus ein überdachter Übergang zum Bahnhof führte. Doch in der Halle drängelten sich ebenfalls nasse Menschen. Außerhalb der Halle peitschte der Regen über die Gleis und, riss den Kies des Gleisbetts mit sich. Wage nahm Eva die Schemen eines Zuges wahr.
„Machen se sich keene Hoffnung, Frollein“, wurde sie aber gleich informiert. „Der steht da schon zehn, fuffzehn Minuten und muckt keen bisschen.“
„Ein Skandal“, schimpfte prompt ein anderer. „Wir frieren uns hier zu Tode.“
„Der jehört anjezeijt“, fiel ein Dritter ein.
„Ganz meine Meinung“, stimmte der Zweite ein. „So eine Feigheit, das ist doch kriminell. Hat der Angst, sein Zug schwimmt ihm weg?“
„Aber der Kies auf den Schienen könnte vielleicht die Wagen aus dem Gleis springen lassen“, mischte sich ein Vierter ein.
„Reden sie nicht, Mann“, konterte wieder Nummer Zwei. „Deutsche Technik muss mit ein bisschen Kies fertig werden. Das ist Feigheit, sage ich. Ganz klar Feigheit!“
Eva war geneigt, den Nothalt aller Schienenfahrzeuge für ganz vernünftig anzusehen, musste dem Polterer aber doch in Bezug auf die Temperaturen Recht geben. Nach zwei Minuten Zähneklappern war sie überzeugt, dass alles andere besser war, als hier weiter herumzustehen. Lieber ein ordentlicher Marsch! Sie verlies den Bahnhof und schlug unter der Hochbahntrasse kräftig aus. So vor dem Regen geschützt, aber begleitet von Wasserfällen zur Linken und zur Rechten schritt sie kräftig aus, um warm zu werden. An den Imbissbuden rund um die Bahnhöfe standen einige Menschen, die sich anscheinend vor dem Wolkenbruch hierher hatten retten konnten. Gelegentlich fuhr auf der Straße unter lautem Gebimmel eine Feuerwehrspritze vorbei. Als Eva an der Landwehrkanalbrücke das schützende Dach der Hochbahn aufgeben musste, hatte der Regen ein wenig nachgelassen. Dafür machten ihr mehr und mehr ihre völlig durchweichten Sommerschuhe zu schaffen. Während sie ihren Weg entlang des Kanals fortsetzte, hatte sie das Gefühl, das ihre Blasen von Schritt zu Schritt größer wurden. Ihr Ziel war die Potsdamer Straße. Dort verkehrten neben rund 30 Straßenbahnlinien auch Omnibusse. Sie hoffte jedenfalls inständigst, dass sie verkehrten.
An der Haltestelle warteten schon einige Menschen, allerdings ohne sichtbare Zeichen von Ungeduld, was Eva hoffnungsvoll stimmte, dass bald ein Bus zu erwartet wurde. Sie hatte ihn dringend nötig. Nicht nur, dass ihre geschundenen Füße auch im Stehen wehtaten, ihr war auch ganz erbärmlich kalt. Von den anderen Wartenden schien keiner nur annähernd so durchnässt wie sie. Es waren fast ausnahmslos Herren, mit Schirmen ausgestattet und in solide Mäntel und Jacken gehüllt. Offenbar standen hier nur Menschen, die sich ausreichend gewappnet in den Regen begeben hatten. Während sie sich so umschaute, musste sie feststellen, dass auch sie Aufmerksamkeit erregte. Ein paar jüngere Kerle stießen sich an und wiesen eineinander grinsend auf sie hin. Andere musterten sie mit offener Neugier oder einem süffisanten Lächeln. Allmählich wurde Eva bewusst, wie unmöglich sie aussehen musste. Ein schneller Blick bestätigte peinlichste Befürchtungen. Allein die Art, wie ihre nasse Bluse eng am Körper klebte, war so unanständig, dass sie die Augen schnell wieder abwandte.
In diesem Augenblick kam der Autobus. Einer der Männer, die sich angestoßen hatten, forderte sie mit einer übertriebenen Geste auf, vor ihm einzusteigen. Seine Freunde grinsten schon wieder breit. Eva war klar, dass sie sich unmöglich die ganze Busfahrt über den Blicken dieser oder anderer Männer aussetzen konnte. Oder gar im überfüllten Autobaus gegen jemanden gedrängt werden wollte. Sie machte kehrt. Dann lieber weiter laufen! Eisern kämpfte sie sich weiter Richtung Charlottenburg und versuchte die wieder fahrenden Straßenbahnen zu ignorieren. Aber deren Gebimmel und Gequietsche klang ihr höhnisch in den Ohren. Um etwaigen Blicken in der belebten Gegend rund um den Zoo zu entgehen, bog sie in den Tiergarten ab und quälte sich durch verschlammte Wege. Jeder Schritt wurde von schmatzenden Geräuschen begleitet, die sowohl der Morast auf den Wegen wie das Wasser in ihren Schuhen von sich gaben. Fall die Flüssigkeit in ihren Schuhen wirklich Wasser war und nicht etwa Blut. So wie ihre Füße schmerzten war Eva inzwischen geneigt, Letzteres anzunehmen. Außerdem kam sie auch mit schnellem Ausschreiten nicht mehr gegen die erbärrmliche Kälte an. Da half nur eine Droschke! Also schlug sie sich zur Charlottenburger Allee durch und versuchte eines der Gefährte heranzuwinken. Vor einem Droschkenkutscher war ihr ihr Aufzug nicht allzu peinlich. Die lebten schließlich davon, dass Leute sich aus den diversesten Gründen nicht den öffentlichen Bahnen und Bussen aussetzen mochten, und hatten mit Sicherheit schon Schlimmeres gesehen. Doch es regnete noch immer und alle Droschken, die sie passierten, waren bereits belegt.
Eva war schon am Verzweifeln, als endlich eine hielt. Der Verschlag wurde von innen geöffent und ein Herr beugte sich heraus. „Schnell, steigen Sie ein!“, rief er ihr zu.
Eva zögerte. Aber die Kälte und ihre Füße drängten sie, nicht feige zu sein. „Fahren Sie ebenfalls nach Charlottenburg und wären so liebenswürdig, ihre Droschke ein Stückweit mit mir zu teilen?“, erkundigte sie sich.
„Aber selbstverständlich! Kommen Sie herein!“
Eva ergriff die angebotene Hand, merkte aber, dass ihr Herz klopfte. In diesem Aufzug zu einem wildfremden Herrn in die Droschke steigen … Ob das wirklich klug war?
„Du lieber Himmel, Sie sehen aber aus …“, rief der Insasse. „Warten Sie, es ist doch bestimmt eine Decke vorhanden!“
Eva nahm die Umhüllung erleichtert entgegen und wickelte sich schnell ein. „Glauben Sie mir, es war mehr als ein unglücklicher Umstand nötig, um mich in eine derart missliche Lage zu bringen“, versicherte sie.
„Das glaube ich gerne“, erwiderte ihr Retter. Er war noch relativ jung, wahrscheinlich noch keine dreißig, gut gekleidet und nahm ihre Erzählung mit Amüsement entgegen. „Sie sind tatsächlich von der Luisenstadt bis hier her gelaufen?“
„Hätte ich Wanderstiefel an den Füßen gehabt, hätte ich es auch nach Hause geschafft. Aber so …“ Sie streckte ihre Füße mit den ramponierten Sommerschuhen vor.
Der Mann ließ ein mitfühlendes Lachen hören. „Aber Sie müssen doch auch halb erfroren sein? Es ist unglaublich kalt geworden. Keine zehn Grad mehr schätze ich und heute Mittag stand das Thermometer noch bei 27.“
„Ich schätze, da haben alle Herren uns Frauen noch um unsere leichte Kleidung beneidet“, gab Eva zurück. „So können sich die Verhältnisse innerhalb weniger Stunden ändern.“
Ihr Retter bestand darauf, sie mit der Droschke nach Hause zu bringen und begleitete sie noch bis vor die Wohnungstüre. Lore öffnete, doch schon im nächsten Moment tauchte Evas Mutter auf. „Du lieber Himmel, Kind“, rief sie aus.
Ihr Begleiter zog seinen Hut. „Ich konnte ihrem Fräulein Tochter glücklicherweise mit meiner Droschke behilflich sein zu können“, erklärte er und reichte Magda Hoffmann seine Karte. Und zu Eva gewandt meinte er: „„Bleiben Sie gesund, unerschrockene Wanderin! Es war mir ein Vergnügen, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Wenn ich mich nun empfehlen darf …“
Natürlich fiel, kaum dass er außer Hörweite war, ihre Mutter über sie her. Mit vielen Handtüchern und noch mehr Fragen. „Warum bist du nicht zurück in die Redaktion? Dein Vater hätte dir eine Droschke besorgen können?“
„Es fuhren gar keine und ich wäre patschnass dort herumgesessen. Da erschien mir die Hochbahn günstiger. Wie sollte ich ahnen, dass sie auch nicht fährt?“
„Aber zu einem fremden Herrn in die Droschke steigen …? Er scheint ja wirklich ein Kavalier gewesen zu sein, aber man weiß doch nie …“
„Mama, es war immerhin eine öffentliche Droschke! Ich hätte es nicht bei einer Privatkutsche getan. Wenn es zu Unnehmlichkeiten gekommen wäre, hätte es doch noch den Kutscher gegeben.“
Ihre Mutter seufzte. „Nun ja, es ist ja alles gut gegangen! Wenn du nur nicht krank wirst.“
Mittwoch, der 8. Juli 1914
Nach ihrem Abenteuer vom Vortag nahm Eva nur zu gerne das liebevolle Angebot ihrer Mutter an, sich ihr Frühstück ins Bett servieren zu lassen, obwohl sie relativ sicher war, keine schlimmeren Malaisen als Blasen an den Füßen davongetragen zu haben. Nun ja, da zeigte sich eben der Unterschied zwischen einem Wandervogel und einer Zierpuppe!
Trotzdem dehnte sie ihr Frühstück bis zum Mittag aus und widmete sich eingehender Zeitungslektüre. Doch die politischen Wogen schienen sich allerorten zu glätten. Ein Ministerrat in Wien hatte anscheinend nur Verwaltungamaßnahmen für Bosnien und Herzegowina beschlossen, jedoch keine wie immer gearteten Schritte gegen Serbien. Gleichzeitig meldeten die deutschen Zeitungen, dass die Wiener Neue Freie Presse aus „besonderen Kreisen“ erfahren haben wollte, dass Russland jeden österreichischen Schritt unterstützen werde, solange dieser nicht gegen die serbische Souveränität gerichtet sei. Selbst der österreichisch-serbische Pressekrieg schien etwas abzuflauen und in Wien kreisten die hitzigsten Diskussionen anscheinend inzwischen darum, ob das Beerdigungszeremoniell, dass das Kaiserhaus seinem ermordeten Thronfolger und dessen unstandesgemäßer Gattin gegönnt hatte, angemessen, doch recht ärmlich oder gar im höchstens Maße empörend gewesen sei. Die meisten k.u.k-Untertanen tendierten offenbar zu Letzterem und grollten ihrem greisen Kaiser und dessen konservativen Beratern, die angesichts der besonderen Todesumstände der Verblichenen nicht über ihren Schatten zu springen vermocht hatten.
Nur die Kreuzzeitung schrieb, angesichts des Attentates wäre es nicht verwunderlich, wenn man in Österreich Maßregeln bedenke, um Serbien eine direkte Nachbarschaft zu Bosnien, Herzegowina und Montenegro zu verbauen. Dies schien so hanebüchen, dass Eva sich endlich aus dem Bett getrieben fühlte, um ihren Schulatlas zu holen. Doch ein kurzer Blick auf die Karte des Balkan bestätigte sie, dass Serbien derart lange Grenzen mit all diesen Staaten teilte, dass es unmöglich war, sich vorzustellen, wie Österreich-Ungarn da etwas „verbauen“ wollte. Entweder schrieb die Kreuzzeitung blühenden Blödsinn oder sie hatte ihre Informationen von Leuten, die ungefähr so viel von Geographie verstanden wie ihr kleiner Bruder.
Am Nachmittag gab Eva die Faulenzerei dann endlich auf, um zum Nestabend ihrer Wandervögel-Gruppe zu gehen. An der Gartentür der Hergesells stieß sie mit Moritz Odenwald zusammen.
„Du hast dich im Tag getäuscht“, begrüßte sie ihn. „Heute ist Mädelsabend.“
Doch Moritz verzog sein hübsches Gesicht zum charmantesten Begrüßungslächeln. „Heil, Wanderschwester! Ich will zu euch. Ich habe euch etwas Interessantes zu berichten.“
Eva bemühte sich um einen bitterbös-skeptischen Blick, der Moritz zum Einen signalisieren sollte, dass sie sich wenig von seiner Ankündigung versprach, und zum anderen sowieso nichts von ihm persönlich hielt. Moritz jedoch lächelte so zuckersüß weiter, als hätte es nie auch nur die kleinste Verstimmung zwischen ihnen beiden gegeben.
Leider waren ihre Wanderschwestern zu einem großen Teil dumme Gänse, die durch Moritz Anwesenheit sofort in pure Verzückung versetzt wurden und seine Ankündigung mit begeisterten Geschnatter bedachten.
„Etwas Interessantes? Uns?“
„Da sind wir aber neugierig.“
„Sag doch?“
„Was kann das bloß sein?“
Eva hätte Else, Inge, Hedi und Lotti am liebsten gepackt und ordentlich durchgeschüttelt, damit sie wieder zu Verstand kamen. Jedoch auch Frieda erteilte Moritz sofort das Wort, nachdem sie den Abend eröffnet hatte.
„Ihr wisst, dass wir mit Kameraden aus Braunschweig auf Fahrt waren“, nahm dieser den Faden auf. „Wir sind gerade erst am Sonntag zurückgekommen. Nun haben uns die Braunschweiger erzählt, dass sich auch bei ihnen eine Mädelsgruppe gegründet hat. Die jedoch sind alle noch recht jung und unerfahren. Deshalb haben wir uns gedacht, dass ihr den Braunschweiger Küken ein wenig unter die Arme greifen könnt und ihnen beibringen, was Wandervogelleben ausmacht.“ Wohlwollendes Nicken in der Runde rings herum. „Natürlich kommt das ein bisschen plötzlich“, erklärte Moritz weiter. „Aber die Braunschweiger haben ein prima Nest, wo ihr hausen könnt, und auch sonst werden sie alles bestens für euch vorbereiten. Ihr habt doch eure Fahrkarten nach Jena noch nicht gekauft, oder?“
Er erntete verwirrte Blicke. „Du willst doch nicht ernsthaft vorschlagen, dass wir am Sonntag nicht ins Saaletal fahren, sondern stattdessen nach Braunschweig?“, vergewisserte sich Eva entgeistert. Doch es zeigte sich, dass Moritz genau dass im Sinn hatte. Mit dem sonnigsten Lächeln erklärte er es zur wunderbaren Fügung, dass seine Wanderschwestern just in dem Moment, wo ihre Hilfe gefragt sei, sowieso schon eine Reise geplant hätten.
Eva konnte nur den Kopf schütteln. „Du bist ja verrückt.“
„Eva“, mahnte Frieda. „Moritz hat lediglich eine Idee vorgetragen …“
„Unsere Fahrt absagen? Nie und nimmer“, rief auch Rike leidenschaftlich aus.
„Aber … “, setzte Moritz mit bestem Reklame-Lächeln an, „… natürlich sollt ihr eure Fahrt machen. Aber eben nach Braunschweig. Ihr könnt dort all das machen, was ihr im Saaletal auch gemacht hättet, nur zusammen mit den dortigen Mädeln, was bestimmt noch mehr Spaß machen wird.“
Prompt begannen Inge und Hedi schwankend zu werden und interessierte Fragen nach dem Nest der Braunschweiger und den dortigen Verhältnissen zu stellen.
„Das ist nicht das Gleiche“, stellte Eva klar. „Wir wollen nicht in ein Nest in der Stadt fahren! Das haben wir das ganze Jahr über hier auch.“
„Es ist gar nicht weit von dort bis ins Grüne.“
„Das ist es in den Grunewald auch nicht.“
„Ihr werdet einen Riesenspaß mit den Braunschweigerinnen haben, das versichere ich euch. Denkt doch mal, wie nett es wäre, ihnen alles beizubringen, das Abkochen, den Umgang mit der Karte, eure Lieder …“
„Moritz, du redest Unsinn“, ereiferte sich Eva. „Das können ihnen die Braunschweiger Jungs auch beibringen. Einem Kochtopf ist es egal, ob ein Mädel oder ein Bursche den Hordenpamps rührt. Wir wollen auf Fahrt gehen. Wandern!“
Moritz Lächeln schwand. Seine braunen Augen wurden groß und traurig. „Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so unkameradschaftlich sein würdet.“
„Aber das sind wir doch gar nicht“, fiel Elschen eifrig ein. „Ich würde gerne nach Braunschweig fahren.“ Sofort bekam sie einen Dankesblick, ders sie wonnig aufstrahlen ließ.
„Das kommt überhaupt nicht in Frage“, konterte Eva schnell. „Wir haben eine Fahrt geplant und wir gehen auf Fahrt.“
„Genau“, pflichtete Rike bei.
„Aber warum nicht nach Braunschweig statt ins Saaletal?“, meinte Hedi. Auch sie erhielt ein warmes Lächeln als Belohnung.
„Ich bitte euch wirklich herzlich, euch die Sache zu überlegen“, schob Moritz eindringlich nach und sandte werbende Blicke nach allen Seiten. „Ich war mir sicher, dass ihr nicht zögern würdet und habe den Braunschweigern mein Wort gegeben …“
„Dazu hattest du kein Recht“, fiel Eva empört ein.
„Sie freuen sich so sehr auf euch“, fuhr Moritz ungerührt in Richtung der anderen fort. „Und ihr wisst doch: Das Wichtigste bei uns Wandervögeln ist doch die Kameradschaft.“
„Und warum habt ihr euch dann nicht der Braunschweiger Mädel angenommen?“, giftete Eva, wurde jedoch sofort von Inge und Elschen niedergeplappert, die eifrig erklärten, dass Mädel natürlich besser von Mädeln lernten.
‚Ringelreihen tanzen’, kommentierte Eva in Gedanken böse. ‚Und andere nette Häuslichkeiten.’ Manchmal fragte sie sich, warum Mädchen wie Else, Inge oder Hedi Wandervögel geworden waren. Aber ihre Eltern waren mit den Hergesells bekannt und Frieda hatte sich zugegebenermaßen sehr ins Zeug gelegt, um überhaupt eine Mädchenhorde in Charlottenburg auf die Beine zu stellen.
Am Ende einigte man sich darauf, abzustimmen. Eva war sich sicher, zumindest ein Patt zu erzielen. Lea, Lilo und Rike würden sich sicher die Fahrt nicht ausreden lassen wollen. Doch auch Lilo war für Braunschweig:
„Danke“, strahlte Moritz. „Ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet.“
Eva konnte es nicht mehr ertragen. Sie stand auf.
„Aber wo willst du denn hin?“, wurde sie prompt gefragt. „Wir müssen doch planen …“
„Ohne mich“, erklärte sie entschieden.
„Aber, Eva“, tönte es im Rund und Elschen sah besonders betroffen aus. „Das kannst du doch nicht machen. Wir gehören doch zusammen …“
Zusammengehörigkeit war ungefähr das Letzte, was Eva gerade empfand. Um das Maß voll zu machen, bekam sie auch noch einen traurigen Blick von Moritz. „Manchmal frage ich mich wirklich, Eva, ob du unsere Ziele wirklich verstanden hast?"
Natürlich verlor sie die Beherrschung. „Erzähl du mir nichts von Kameradschaft“, schrie sie ihn an. „Denn, wenn einer nicht weiß, was das ist, dann bist das du! Wie kannst du es bloß wagen, in unserem Namen Zusagen zu geben, ohne uns vorher zu fragen? So handelt kein Kamerad, sondern jemand, der meint über andere bestimmen zu können! Und wage nicht zu behaupten, es wäre selbstverständlich, nach Braunschweig zu fahren. Es gäbe Tausende Möglichkeiten, den Mädeln dort beizustehen, ohne unsere Fahrt abzusagen. Wir hätten die Leiterin einladen können, mit uns ins Saaletal zu fahren. Sie hätten nach unserer Fahrt nach Berlin kommen können. Wir hätten uns im Herbst treffen können … Dass wir unsere Fahrt absagen dient einzig und allein dir, damit du vor den Braunschweigern nicht als Aufschneider und Windbeutel da stehst, und dabei helfe ich bestimmt nicht mit.“ Und damit drehte sie sich um und knallte die Tür des Gartenhäuschens hinter sich zu.
Draußen vor dem Tor verstand Eva zweierlei: Wie sich ein Dampfkessel kurz vor dem Explodieren anfühlte und warum die englischen Sufragetten manchmal keinen anderen Ausweg mehr sahen, als Bomben zu werfen. Mit heldenhafter Selbstbeherrschung gelang es ihr, nicht auf offener Straße zu schreien und auf nichts einzuschlagen. Stattdessen stürmte sie nur mit völlig undamenhaften Schritten nach Hause. Sie stand schon vor der Tür und kramte nach ihrem Schlüssel, als ihr bewusst wurde, dass die heimatliche Wohnung kein sicheres Asyl sein würde. Denn dort wartete ihre Mutter. Die würde natürlich Verständnis für ihre Enttäuschung äußern, nicht aber für ihren Zorn. Außerdem stand zu erwarten, dass sie sehr schnell versuchen würde, die Sache ins Poitive zu wenden. Eva konnte ihre aufmunternde Rede, dass es doch bestimmt auch in Braunschweig nett werden würde, mühelos in Gedanken selber formulieren.
Also musste ein Plan her, dem zu entgehen. „Ich habe Vater versprochen, noch in der Redaktion vorbei zu schauen“, log sie ihrer Mutter also eiskalt vor. Die reagierte verwundert, bat sie aber dann lediglich, bei Wertheim Plötzen zu besorgen.
Eva hasste Plötzen, deren feine Gräten unfehlbar nervtötende Dramen mit Alfie heraufbeschworen. Zwar waren sie der Lieblingfisch ihres Vaters, aber wer ging einkaufen? Sie oder er? Eva war schwer versucht, lieber Ostseelachs zu kaufen und gegenüber ihrer Mutter zu behaupten, Plötzen seien schon aus gewesen. Doch dann fiel ihr ein, dass ihr zwei Wochen ohne ihre Freundinnen bevorstanden. Zudem versprach das Wetter nasskalt zu bleiben. Wenn sie sich nicht zu Hause zu Tode langweilen wollte, war es besser, sich gut mit ihrem Vater gut zu stellen.
Sie wurde jedoch in der Redaktion mit einem eher barschen „Was willst du schon wieder hier?“ begrüßt.
Eva setzte ihr nettestes Lächeln auf. „Mama hat mich gebeten, bei Wertheim Plötzen für dich zu besorgen.“
Die Lüge tat ihre Wirkung. „Das ist schön!“, erwiderte er sichtlich erfreut. „Aber entschuldige mich einen Moment, Kind. Wir müssen die letzten Fahnen in die Druckerei bringen. Theo, haben Sie den Nachruf auf diesen Flugakrobaten fertig?“
„Georges Legagneux war kein Luftakrobat“, engegnete Theo gekränkt. „Er war ein erstklassiger Flieger mit soliden Kenntnissen der Materie. 1913 hat er den Weltrekord im Hochflug aufgestellt. 6120 Meter. Alle anderen Versuche danach sind nicht mehr anerkannt worden. Dass so einer mit nur 31 Jahren verunglückt, ist wirklich eine große Tragödie für den Luftsport.“
„Jaja“, wehrte sein Chef ungeduldig ab. „Das haben Sie bestimmt sehr gut dargestellt. Bruno, was ist mit diesen Volksparkplänen an der Baerwaldbrücke?“
„Bin gerade beim Schlusssatz.“
„Und Sie, Paul, haben nichts über diesen angeblichen Schritt in Serbien herausgefunden?“
Paul winkte resigniert ab. „Ich habe mich wirklich dahinter geklemmt, aber niemand weiß etwas. Das bleibt das Geheimnis des Tageblattes, wie sie zu dieser Behauptung gekommen sind. Mal sehen, was in den Abendzeitungen steht.“
Prompt vergaß Eva alle Pläne, sich ihrem Vater gegenüber diplomatisch und gewinnend zu verhalten. „Ein Schritt gegen Serbien?“, rief sie alarmiert.
„Nichts Genaues weiß man nicht“, gab ihr Vater zurück. „Laut dem Tageblatt plant die österreichische Regierung einen solchen. Aber sonst weiß wohl niemand davon.“
„Hast du die Morgenausgabe der Kreuzzeitung gelesen?“
„Kreuzzeitung? Nein, dazu bin ich nicht mehr gekommen. Gab es etwas Interessantes?“
Eva berichtete über ihre morgendliche Entdeckung. Ihr Vater tat den Bericht natürlich sofort als Unsinn ab: „Serbien die Nachbarschaft zu Bosnien, Herzegowina und Montenegro verbauen? Das ist völlig unmöglich. Da musst du etwas falsch verstanden haben, Mädchen.“
Bruno jedoch hatte sich schon daran gemacht, die Kreuzzeitung herauszusuchen. „Ihre Tochter hat Recht. Das schreiben die so. Und zwar Chefleitartikler Theodor Schiemann höchstpersönlich.“
Arthur Hoffmann schüttelte nocheinmal den Kopf. „Denen ist in der Redaktion wohl die Schnapsflasche durchgegangen. Wie soll so etwas gehen?“
Paul jedoch zeigte sich beunruhigt: „Klingt als wollten sie den Sandschak zwischen Serbien und Montenegro wiedererobern.“
„Dann macht morgen Russland mobil“, gab sein Chef zurück. „Außerdem haben in London alle Großmächte zugestimmt, dass der Sandschak zwischen Serbien und Montenegro geteilt wird. Und was wollen die Österreicher an der serbisch-bosnischen Grenze machen? Eine hohe Mauer errichten?“
„Eine militärische Sperrzone?“, schlug Paul vor.
„Viel zu aufwändig.“
„Damals gegen die Türken haben sie in der kroatischen Krajna Serben angesiedelt, um einen Puffer zum Osmanischen Reich zu haben.“
„Und das haben ihnen die Serben bis heute nicht verziehen“, warf Bruno ein. „Aber wir könnten ihnen im Zug der unverbrüchlichen deutsch-österreichischen Freundschaft natürlich ein paar Lothringer abtreten, um sie an der bosnisch-serbischen Grenze anzusiedeln. Im Gegenzug nehmen wir in Lothringen bosnische Serben auf, die zwar von einem Großserbien träumen, aber wenigstens nicht zurück nach Frankreich wollen.“
„Bei den Alldeutschen gäbe es wahrscheinlich einige, die würden Hurra schreien“, gab Paul mit ungewohntem Sarkasmus zurück.
„Über die Balkanpolitik kann man wirklich keine Witze machen“, ergänzte sein Arbeitgeber. „Keine Idee ist so absurd, dass sie nicht Befürworter fände.“
Wenig später kam der Redaktionsbote mit den ersten Abendzeitungen.
„Ist das Tageblatt dabei?“, erkundigte sich Paul sofort begierig.
„Die sind eigentlich immer sehr schnell. Ja, da ist es.“
Arthur Hoffmanns Lieblingsmitarbeiter griff nach der Zeitung. „Oh, nein“, stöhnte er nach einem kurzen Blick. „Jetzt schreiben sie plötzlich, dass doch noch keine Aktion in Belgrad geplant ist. Auf eine solche Falschmeldung opfert man einen halben Tag. Naja, es war ja eigentlich auch zu erwarten. Eine kopflose Aktion hätte schon längst stattgefunden und für eine vernünftige, überlegte ist es zu früh. Die amtlichen Untersuchungen in Sarajewo dürften noch kaum abgeschlossen sein.“
„Was schreiben sie zu Albanien? Haben sie mehr als wir?“, erkundigte sich der Verleger.
„Das nicht. Aber sie sehen schwarz, reden schon vom aufgegebenen Fürsten Wilhelm.“
„Was gibt’s im Vorwärts, Theo?“
Der von seinem Chef weniger geschätzte Sportreporter lachte auf. „Politisch nichts Besonderes. Aber da gibt es eine echt sozialistische Rührstory. Das müsst ihr euch anhören. In Ungarn soll eine Frau, nachdem ihr Kind gestorben ist, aus ihrer eigenen Milch Butter gemacht und verkauft haben, um zu überleben. Schlusssatz: ‚Die bürgerliche Welt aber opfert hunderte Millionen dem nimmersatten Militarismus, während Proletarierfrauen ihre Muttermilch verkaufen müssen.’“
Von seinen Kollegen erntete er dafür eher müde Zeichen der Verachtung, von denen nicht ganz klar war, ob sie wirklich dem Vorwärts oder nicht doch eher Theo galten. Eva jedoch konnte sich wieder einmal nicht zurückhalten. „Oh, hier gibt es auch Rührstorys“, rief sie und klopfte auf die Seiten der katholischen Germania vor sich. „Wirklich üble Rührstorys. Unter dem Titel ‚Kindermund über das Ereignis von Sarajewo’. Die lieben Kleinen sagen zum Beispiel: ‚Wenn es nun Krieg gibt, muss mein Vater auch mit, wir haben gestern alle geweint, aber unser Vater hat gesagt, da kann man nichts machen, es gilt die Ehre Österreichs, und wenn ich nicht mehr komme, wird das Vaterland für euch sorgen.’ Oder: ‚Die Serben g’hörn g’salzen!’ Oder: ‚Mein Vater hat gesagt: Ich bin gegen den Krieg, aber bei diesen Mördern hilft nichts anderes.’“
„Ja und?“, meinte Theo. „Warum regt sie das so auf? Wer nimmt Kindergequatsche ernst?“
„Jeder“, giftete Eva. „Kindermund tut Wahrheit kund. Gerade weil's, so kindlich nett und schlicht und einfach ist. Der Horizont der meisten Leute geht doch auch nicht höher hinaus!“
Bruno lachte: „Nanana, Fräulein Hoffmann. Da sprach aber eben nicht die wahre Liebe zum Proletariat aus ihnen.“
„Eva, bitte“, versuchte ihr Vater sie zur Räson zu rufen.
„Aber es ist doch so“, wehrte sie sich. „So reden die Leute. Ihr habt ja keine Ahnung! Selbst Alfie, der zu Hause bestimmt kein chauvinistisches Wort zu hören bekommt, glaubt schon, dass die Serbsen kleine Kinder fressen.“
„Eva! Das hier ist eine Presseanalyse und kein Debattierclub!“, fühlte sich Arthur Hoffmann bemüssigt, klarzustellen.
„Nun gut“, gab sie klein bei. „Was haltet ihr davon? Unter der Überschrift ‚Die Rückendeckung der serbischen Verschwörer’ meldet die Germania, dass Russland seine Manöver bis zum 1. Oktober verlängert hat. Augenblicklich stehen 650.000 Mann unter Waffen und die Germania schließt daraus, dass die serbische Regierung Russland vorher von dem Attentat unterrichtet hat und Russland sich nun schon einmal bereit macht, einen Überfall Österreichs auf Serbien zu verhindern.“
Theo piff unwillkürlich. „Das ist wirklich ein dicker Hund.“
„Das ist doch kompletter Unsinn“, hielt Paul dagegen.
„Warum denn?“, meinte Theo. „Von den wahren Intrigen der Politik ahnen wir bideren Zeitungsleute gar nichts.“
„Russland hat in seiner jetzigen Situation allen Grund, Serbien zurückzuhalten“, gab Paul zurück. „Überall heißt es, sie würden darauf rüsten, in zwei, drei Jahren Krieg führen zu können. Selbst das ist zweifelhaft! Aber bestimmt brechen sie jetzt keine Auseinandersetzung vom Zaun! Hätte die Serben, beziehungsweise diejenigen Kreise in Serbien, die nun tatsächlich in das Attentat eingeweiht waren, was vermutlich nicht für die Regierung gilt, wirklich etwas von dem Attentat Richtung Serbien verlauten lassen, wären sie schön zurückgepfiffen worden.“
„Du kannst die Russen doch nicht mit unseren mitteleuropäischen Maßstäben messen!“, warf Theo ein.
„Deshalb sind sie noch lange keine Idioten. Aus welcher Quelle schöpft die Germania denn ihre Weisheit?“
„Verrät sie nicht“, erklärte Eva mit unverhohlenem Triumph in der Stimme.
„Es dürfte sich also um die phantasievollen Gedanken eines russophoben Redakteurs handeln“, schloss Paul. „Nicht weiter ernst zu nehmen!“
„Ich weiß nicht, ich weiß nicht“, beharrte Theo. „Ich traue den Russen nicht und den Serben noch viel weniger.“
„Und wenn sie uns nicht trauen, schreit alles entsetzt auf“, kam es wieder von Eva.
Theo lachte spöttisch: „Na, ich meine, dass unserer Regierung doch ein wenig mehr zu trauen ist als der serbischen. Bei denen gilt es doch noch als Heldentat dem Gegner die Kehle aufzuschlitzen.“
„Theo!“, kam Arthur Hoffmann einem weiteren Ausbruch seiner Tochter zuvor. „Eva! Bleibt gefälligst bei der Sache.“
„Dass Russland vorher informiert war, ist natürlich Unsinn“, nahm Paul den Faden wieder auf. „Dass sie die Manöver verlängern, kann natürlich schon bedeuten, dass man in St. Petersburg mit einer ernsten Krise rechnet oder sie zumindest nicht ausschließt.“
„Das ist richtig“, stimmte sein Chef zu. „Das müssen wir beobachten. Gibt es sonst noch was? Bruno?“
Der machte eine verneinende Geste. „Heute scheint der Rührstorys zu sein. Sogar das Tageblatt macht mit. Es war nämlich zu Besuch an der Danziger Bucht und da darf ein Blick auf die kronprinzliche Villa in Zopot nicht fehlen. Der Reporter drängte sich also mit Hinz und Kunz vor den Toren und beobachtete von weitem den Kronprinzen in Badehose und weißem Südwester in einem Canoe. Oder auf dem Tennisplatz. Oder wie sich die drei Prinzlinge mit Indianergeheul auf Pappi stürzen. Und dazu lassen sich so bemerkenswerte Aussagen der Mitgaffer einfangen wie ‚Guck, Lottchen, er hat den Ball getroffen’ oder ‚Trudchen, hast du gesehen, wie der Kronprinz seine Frau anlächelte?’ ‚Ja, er ist ein guter Ehemann.’ ‚Ernst, dass du mir immer den Tennisschläger hältst wie der Kronprinz’.“
Arthur Hoffmann verzog das Gesicht. „Ausgerechnet der Kronprinz!“
„Wilhelm Zwo ist ja schlimm genug“, vergass seine Tochter wieder alle Zurückhaltung, „aber Gott bewahre uns vor dem Frettchen.“
Theo verstand nicht: „Dem Frettchen?“
„Na, dem Kronprinzen! Er sieht doch so aus.“ Eva brachte damit einen Lachanfall bei Theo, Bruno und sogar Paul zustande. Dafür verlor der alte Johannsen seine gewohn nachsichtige Miene.
„Nee, Fräulein Eva, allet, wat recht ist. Aber jetzt geh’n Se zuweit. Det is immerhin unser künftiga Kaisa.“
„Leider“, platzte Eva heraus.
Der Chefredakteur jedoch schüttelte energisch den Kopf: „Nee, nee, nee! Man sieht ’nem jungen Mädchen wie Ihnen vielet nach. Wir warn ooch mal jung un respektlos. Aber so dürfense nich über die Monarchie reden. Da ist wat dran, wat über solche Kritik erhaben is. Im Kaiserhaus sin die deutschen Völker verbunden.“
Eva lagen allerlei Antworten auf der Zunge, die sie vielleicht Theo gegeben hätte, sich aber dem alten Johannsen gegenüber doch nicht zu sagen traute.
Doch da sprang ausgerechnet Paul in die Bresche. „Trotzdem“, warf er ein. „Ich kann an eine Zeit, in der Wilhelm der Dritte auf dem Thron sitzt, nur mit großer Sorge denken. Es ist nun einmal nicht zu leugnen, dass der Kronprinz im äußersten rechten Lager steht. Man muss nur ab und zu in die Leipziger Neuesten Nachrichten schauen. Das ist eine ganz üble, finstere Brühe, die mindestens der DTZ gleichkommt. Chauvinismus, Kriegstreiberei und haarsträubende Rassentheorien.“
„Sie wissen doch von unserm Kaiser ooch, dat der mal über’s Ziel hinausschießt mit dem, was er sacht“, wehrte Wilhelm Johannsen ab.
„Womit er schon viel Porzellan zerschlagen hat! Aber der Kronprinz und seine alldeutschen Gesinnungsgenossen – befürchte ich jedenfalls – rasseln nicht nur mit dem Säbel, sondern sind auch entschlossen, ihn zu gebrauchen.“
„Aber dat sin doch allet junge Männa, die müssen doch’n bisschen Dampf ablassen, dette darf man doch nüsch so ernst nehmen.“
Doch Paul schüttelte sein Kopf. „Das ist kein Übermut. Sondern purer Chauvinismus. Und im Grunde Angst: Angst zu kurz zu kommen, Angst, nicht unbesiegbar zu sein, Angst vor unbekannten Nachbarn, denen man nur das Schlechteste unterstellt ... Ein Chauvinist kann erst ruhig schlafen, wenn es weit und breit niemanden gibt, der mächtiger ist als er. Und er wird alles tun, um das zu erreichen. Und ich wage nicht, mir vorzustellen, was es für Deutschland bedeutet, wenn unser künftiger Kaiser das versucht.“
„Det ist doch Wahnwitz, det allet“, unterbrach der alte Johannsen verstört. „Det kannste doch niemand nachsagen, Paul, allet wat recht is.“
Doch nun mischte sich auch noch Bruno mit unverkennbarer Fröhlichkeit ein: „Oh, Deutschland wäre nicht das erste Volk der Geschichte, dass von einem wahnwitzigen Kriminellen in den Untergang geführt worden wäre.“
„Aber det könnt ihr unser’m Kronprinz nich unterstellen … Jutt, er hat bedenkliche politische Ansichten, aber …
„Ich hoffe, dass ich mich in ihm irre“, meinte Paul. „Aber jede seiner Äußerungen bestätigt meine Befürchtungen und was sein Freund Paul Liman und andere in den Leipziger Neuesten schreiben, das schreit förmlich nach Weltkrieg, Feudaldiktatur und Pogromen.“
„Pogromen?“ Eva war fassungslos. „So wie im Mittelalter gegen die Juden?“
„Solange sind die letzten noch gar nicht her. Vor allem in Osteuropa nicht.“
„Aber doch nicht hier bei uns“, entsetzte sich Eva.
Paul hob die Schultern. „Diese Kerle äußern sich in einer so menschenverachtenden, militanten, antisemitischen Weise, dass man befürchten muss, dass soetwas passieren kann.“
„Aber nein, da sehen Sie nun wirklich zu schwarz“, mischte sich Arthur Hoffmann ein. „Dieser ganze wilde Antisemitsmus war ganz klar ein Produkt des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Aber seither kehrt doch langsam Vernunft ein. Bei den letzten Wahlen haben die Antisemiten nur noch 2,5 Prozent bekommen und mit 10 Sitzen nicht einmal mehr halb so viele wie noch 1907. Selbst in Hessen-Nassau haben sie gewaltig verloren.“
„Diejenigen, die sich nichts anderes als Antisemtismus auf die Fahnen schreiben“, wandte Paul ein. „Aber was bei den Alldeutschen oder auch im Bund der Landwirte über die Juden geredet wird, das ist kein bisschen gemässigter als das, was der Gottseidank verstorbene Adolf Stoecker und seine Gesinnungsgenossen von sich gegeben haben.“
„Ich sage nur Fritz Bley“, warf Bruno ein.
„Ich verstehe das nicht“, klagte Eva. „Ich kann irgendwo noch Nationalismus begreifen. Immerhin bestehen die Konflikte in diesem Fall wirklich zwischen verschiedenen Nationen, die andere Ziele, andere Regierungen, andere Interessen haben. Dass manche da nur ihre Belange im Auge haben und für gewaltsame Lösungen plädieren, ist natürlich falsch, aber nicht ganz unverständlich. Aber das gilt doch nicht für die Juden. Das sind doch Deutsche wie wir. Die sprechen diesselbe Sprache, haben dieselbe Regierung, müssen in derselben Armee Dienst tun, zahlen an denselben Staat Steuern, sind denselben Gesetzen unterworfen … Sie wollen auch nicht den Anschluss an einen anderen Staat wie viele Elsässer oder Polen. Welche Begründung kann es also für Antisemitismus geben?“
„Sie sind anders als wir“, gab Paul zurück.
„Unsinn“, erwiderte Eva. „Das war vielleicht früher so, aber doch nicht mehr heute. Sie gehen in die Synagoge und essen kein Schweinefleisch, was beides nun wahrhaft kein Anlass für Feindseligkeiten sein kann. Aber das war’s doch dann auch schon.“
„Ein Antisemit, Fräulein Hoffmann“, warf Bruno ein, „stellt sich jeden Juden so fremdartig wie die Bewohner des ärmsten und ruckständigsten osteuropäischen Schtetls vor, so reich wie unsere erfolgreichsten und assimiliertesten jüdischen Unternehmer, so verdorben wie alle Kriminellen zusammen und natürlich ist er überzeugt, dass sie kleine Kinder fressen, Hostien schänden und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Kurz, Juden sind für einen Antisemiten der Grund aller Übel auf der Welt, weswegen deren Ächtung oder noch besser Vertreibung aus unserem Land auch alle Übel lösen würde. Das ist doch fein, nicht?“
„Und außerdem glauben sie wahrscheinlich noch an den Klapperstorch?“
„Nein, aber an den bösen Wolf aus dem Märchen“, ergriff wieder Paul das Wort. „Und sie bilden sich ein, dass sie der Jäger sind, der Rotkäppchen retten muss. Aber in Wahrheit haben sie Angst, selber Rotkäppchen oder ein armes, kleines Geißlein zu sein.“
Eva brach in hemmungsloses Gelächter aus. So kannte sie Paul gar nicht.
„Also, ich gehe jetzt“, meldete sich plötzlich Theo zu Wort. „Es ist spät. Die Arbeit ist erledigt, und ich weiß mit meinem Abend Besseres anzufangen, als mir Pauls Märchenstunde von Pogromen in Berlin anzuhören. Gute Nacht miteinander“
„Meine Frau wartet ooch mit’m Essen“, entschuldigte sich der alte Johannsen. „Ich denk, mit der Arbeit sin wir durch.“
„Jaja“, beruhigte Arthur Hoffmann. „Wir werden auch aufbrechen.“
„Mädel, das darfst du mir nicht mehr machen“, stöhnte er, als er mit seiner Tochter in der Hochbahn nach Charlottenburg saß. „Wenn du in der Redaktion auftauchst, arbeiten die Männer ja nicht mehr, sondern quatschen nur noch.“
„Ich habe nicht von den Pogromen angefangen“, erinnerte Eva. „Aber glaubst du wirklich, dass der Kronprinz Antisemit ist und wenn er an die Regierung kommt …“
„Der Kronprinz ist reichlich alldeutsch, aber ich habe keine Ahnung, was er über die Juden denkt“, schränkte Arthur Hoffmann ein. „Und deine Wandervögel sind ja wohl auch nicht frei von Ressentiments. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da doch einen Antrag, Juden auszuschließen …“
„Das war etwas anderes“, verteidigte sich seine Tochter. „Es haben lediglich einige gemeint, dass das Wandern mit der Pflege der eigenen Traditionen einhergehen soll und es deswegen besser wäre, wenn es sowohl deutsche wie jüdische Wandervereine gäbe, wo jeder sein eigenes Volkstum lebt. Die meisten hielten das für blühenden Unsinn, aber da einige dieser Ringelreihen- und Volkslied-Jünger verdiente Wandervogelführer sind, hat man sich entschlossen, es den einzelnen Gruppen zu überlassen, ob sie Juden akzeptieren oder nicht. Bei uns war eigentlich nur Hans Kramer dafür, worauf David, Leas Bruder, meinte, beim Wandern gehe es doch wohl vor allem um die Natur und es tue ihm leid, aber er fühle in seinem Blut keine orientalischen Palmen rauschen. Und überhaupt habe er bisher geglaubt, es sei das Wesen des Wandervogels frei umherzuschweifen und Neues zu entdecken und nicht im ererbten Vorgärtchen sitzen zu bleiben, die angestaubten Traditionen zu pflegen und nur dort zu wandeln, wo man den Geist der Vorväter umgehen spürt. Da gab es großes Gelächter und die Sache war vom Tisch.“
Arthur Hoffmann musste auch lachen. „Es wird wirklich zuviel in den roten Lebenssaft hineingeheimst“, meinte er. „Der Adel sieht ja seit jeher seine Privilegien unter Berufung auf sein edles Blut als Naturgesetz an und natürlich bescheinigt sich jedes Volk die edelste Rasse und sieht andere unrettbar am unteren Ende der Rangleiter.“
„Gar nicht zu reden davon, welch schwächliche Anlagen viele Männer den Frauen zusprechen. Als ob unsere jämmerliche Stellung auch Naturgesetzen und nicht gesellschaftlichen Umständen geschuldet wäre.“
„Nun, manches ist dann schon Natur“, wehrte der Verleger den Konter seiner Tochter schnell ab. „Im Ernst, Mädel, du solltest deine Besuche in der Redaktion etwas einschränken, sonst bekomme ich eines Tages mein Blatt nicht mehr voll. Theo will mit seinen Anzüglichkeiten brillieren, wenn du auftauchst, Bruno mit seinem Sarkasmus, Paul mit seinem Verstand und dem guten, alten Johannsen treibst du noch sein Vertrauen in die heutige Jugend aus. Wann geht deine Gruppe auf Fahrt? Sonntag?“
„Meine Gruppe schon“, wurde er informiert. „Aber ich werde mich zu Hause vergnügen müssen.“
„Wie das?“
Eva erstattete Bericht.
„Und du hältst es für unter deiner Würde, dich mit den Braunschweiger Piepmätzen abzugeben?“
„Ich halte es für unter meiner Würde, mir von Moritz Odenwald vorscheiben zu lassen, dass ich anstatt auf Fahrt ins Saaletal zu gehen, nach Braunschweig fahren muss.“
„Ich dachte, ihr Wandervögel habt keinen Vorsitzenden, der die Aktivitäten bestimmt.“
„Eben“, sagte Eva. „Dieser Meinung bin ich auch. Aber es hieße, diesen Standpunkt zu verrraten, wenn ich mit nach Braunschweig führe. Verstehst du das?“
Arthur Hoffmann seufzte schwer: „Evchen, Evchen, stell mir nur nicht meine Zeitung auf den Kopf!“
Donnerstag, den 9. Juli 1914
Eva saß noch beim Frühstück, als sie Besuch erhielt. Lea und Lilo waren gekommen, um sie zu überreden, doch mit nach Braunschweig zu fahren.
„Ich wäre auch lieber an die Saale gefahren, aber immer noch besser, als die ganze Zeit zu Hause zu hocken“, argumentierte Lea.
Eva dagegen nahm sich Lilo vor: „Du bist schuld! Immer schwärmst du von der unberührten Natur und plötzlich stimmst du für Braunschweig!“
„Ich finde es wichtiger, jüngere Mädchen für uns zu gewinnen, als selber auf Fahrt zu gehen“, hielt ihre Freundin jedoch dagegen.
„Aber Moritz …“
„Worum geht es dir eigentlich wirklich, Eva?“, konterte Lilo gnadenlos. „Um die Saalefahrt oder um Moritz? Was hast du eigentlich gegen ihn?“
Das verriet ihr Eva natürlich nicht. „Er hat kein Recht …“
„Wir haben abgestimmt“, warf Lea ein. „Und auch wenn mir das Ergebnis nicht gefällt …“
„Diese dummen Gänse haben sich von ihm einwickeln lassen.“
„Auch dumme Gänse haben eine Stimme“, erinnerte Lea. „Selbst Elschen. Aber du wärst vermutlich eine glühende Anhängerin unseres preußischen Dreiklassenwahlrechts, wenn nicht das Einkommen, sondern der Verstand zählen würde, nicht wahr?“
Eva rang sich ein zerknirschtes Grinsen ab. Lea kannte sie.
Unterdessen erlebte ihr Vater einen recht ruhigen Tag in seiner Redaktion. Die Nachrichtenagenturen meldeten, dass der k.u.k.-Ministerrat Verwaltungsmaßnahmen für Bosnien und die Herzegowina beschlossen habe. Auch gab es eine Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten Tisza, über einen Schritt gegen Serbien könne man noch keine Angaben machen, aber man werde sowohl das Interesse am Friedenserhalt wie die Österreich-Ungarns Großmachtstellung im Auge behalten. Die Korrespondentenberichte der Zeitungen widersprachen sich. Die Norddeutsche sagte, es sei kein Schritt geplant, Tante Voss wollte wissen, das er bad erfolgen solle, aber keinen Eingriff in serbische Hohheitsrechte darstelle. Das Tageblatt erklärte, Österreich wolle nach Abschluss der Untersuchungen in eigenen Land, weitergehende Untersuchungen in Belgien und Sicherheiten gegen die großserbische Propaganda fordern.
„Ganz so harmlos klingt das nicht mehr“, fand Paul bedenklich. „Sicherheiten! Wie sollen die denn aussehen? Wer weiß, was für verstiegene Vorstellungen den Österreichern da wieder im Kopf herumspuken!“
Arthur Hoffmann hob die Schultern. „Ein paar Zugeständnisse werden die Serben schon machen müssen“, meinte er. „Und nicht nur leere Versprechungen. Aber ich glaube immer weniger, dass Österreich es diesmal wirklich auf eine Konfrontation anlegt.“
Der Balkan-Korrespondent der Voss meldete denn auch, Belgrad plane, weitgehende gesetzliche Beschränkungen des Waffenhandels und eine Überwachung der Mittelschulen.
„Na, also“, kommentierte Arthur Hoffmann, „das klärt sich schon.“
Er war froh, dass seine Tochter sich heute nicht in der Redaktion blicken ließ. Es war ihm immer noch völlig schleierhaft, warum Eva ein so leidenschaftliches Interesse an den aktuellen Ereignissen zeigte. Dass die pauschalen Vorwürfe gegen die Serben ihr Gerechtigkeitsgefühl empörten, konnte er noch verstehen, nicht aber warum jede Erwähnung möglicher Verwicklungen oder auch nur eines österreichischen Schrittes seine sonst so couragierte Tochter geradezu in Panik versetzten.
Es kursierten auch einige andere Nachrichten, die Eva vermutlich dazu gebracht hätten, wieder heiße Debatten anzuzetteln. Etwa ein Artikel in der Vossischen Zeitung, der die Zurechnungsfähigkeit der englischen Sufragetten in Frage stellte. Diese sagten angeblich vor Gericht aus, sie würden wochenlang gemartert und man wolle sie töten, indem man ihnen durch Zwangsfütterung – offenbar befanden sich alle inhaftierten Frauenrechtlerinnen im Hungerstreik – die inneren Organe zerschneiden würde. Eine hatte sich auch beschwert, dass man sie zwinge auf das „militanteste Buch, das je geschrieben worden sei“, zu schwören, womit sie natürlich die Bibel meinte.
„Diese Seelchen haben die Pamphlete deutscher Kriegshetzer noch nicht gelesen“, kommentierte Bruno.
Sein Chef sortierte den Artikel vorsichtshalber aus, bevor er die Blätter am Abend mit nach Hause nahm. Als seine Tochter begann, das Interesse an der mitgebrachten Lektüre zu verlieren, räusperte er sich: „Ich glaube, wir beide müssen mal ein ernstes Wort miteinander sprechen, Evchen.“
Er konnte sich über die Reaktion nicht beschweren. Seine Tochter ließ prompt ihr Blatt sinken und sah ihn alarmiert an.
„Ich wollte es ja erst tun, wenn du wieder von deiner Fahrt zurück bist, aber da du nun nicht fährst …“
Eva fühlte tatsächlich gelinde Panik. Was wollte ihr Vater bloß? Ihr eine grundsätzliche Standpauke über ihr gesamtes Verhalten halten?
„Was gedenkst du eigentlich nach den Ferien zu tun?“, erkundigte er sich mit falsch klingender Harmlosigkeit.
„Wieso Ferien? Ich bin nicht mehr in der Schule.“
„Eben! Und ich frage, was du nun zu tun gedenkst? Bisher hast du keine Andeutungen darüber gemacht. Irgendein Bewerber um deine Hand scheint mir auch nicht in Aussicht. Also? Was sind deine Pläne? Ein Studium? Eine andere Art von Ausbildung?“
Eva nahm ihren Mut zusammen. „Ich möchte Journalistin werden, das weißt du.“
„Und du weißt, dass ich das für keinen geeigneten Beruf für eine Frau halte. Jede Diskussion ist also zwecklos.“
„Aber warum denn nicht?“
„Eva, das ist meine Meinung! Ende der Fahnenstange!“
„Und Alfie muss bestimmt mal Journalist werden, auch wenn er nicht will, um die Zeitung zu übernehmen.“
„Wieso sollte er nicht wollen?“
„Keine Ahnung! Ich glaube, er wird andere Neigungen haben werden.“
„Ach ja? Du machst mich neugierig. Was schwebt dir da so vor?“
Eva überlegte. „Ich weiß nicht. Vielleicht Architekt.“
„Architekt?“ Ihr Vater schien aus allen Wolken zu fallen. „Warum, um alles in der Welt? – Weil er gerne Sandburgen baut?“
„Weil er immer so genaue Vorstellungen von den Dingen hat und dann will, dass die Wirklichkeit auch so ist, wie er sich das denkt. Keine gute Voraussetzung für einen Journalisten, würde ich sagen.“ Sie unterdrückte gerade noch das Argument, dass Klein-Alfie für sein Alter auch noch nicht allzu geschickt mit Worten umging. Diese Tatsache wurmte den gemeinsamen Vater schon genug und trieb ihn regelmäßig zu Sprachübungen, die sich stets unfehlbar zu Heul- und Schreidramen entwickelten.
Arthur Hoffmann war aber offenbar im Moment gewillt, seine Unzufriedenheit der Tochter, nicht dem Sohn zukommen zu lassen: „Jetzt mach aber einen Punkt, Evchen. Dein Bruder ist fünf Jahre und hat noch viel Zeit. – Was für dich nicht gilt! Ich erwarte von dir bis zum Herbst einen akzeptablen Vorschlag. Andernfalls melde ich dich an der Hauswirtschaftsschule an. Denn irgendetwas wirst du machen. Einfach so herumhängen, das ist nicht.“
Eva zog eine Grimasse.
„Warum willst du denn nicht studieren?“, versuchte es ihr Vater im Guten. „Lehrerin zum Beispiel? Wäre das nichts für dich? Da wärst du sogar dazu verpflichtet, immer schlaue Vorträge zu halten.“
„Für Kinder“, gab Eva verächtlich zurück.
„Es will dich ja keiner auf die Volksschule schicken. Wie wäre es mit dem Lehramt für die höhere Schule, hm?“
„Ich will von Erwachsenen ernst genommen werden. Auch von erwachsenen Männern.“
Arthur Hoffmann gab es auf, erhob sich und klatschte seinen Ärger über die Tochter mit seiner Serviette auf den Tisch. „Eva, das ist mein letztes Wort! Entweder ein akzeptabler Vorschlag deinerseits oder die Hauswirtschaftsschule. Ende der Debatte.“
Freitag, der 10. Juli 1914
„Würdest du mir gestatten, eine fotografische Lehre zu machen?“, erkundigte sich Eva am nächsten Abend bei ihrem Vater.
Der sah überrascht aus: „Fotografin? Warum nicht? Aber ich habe bislang nie ein derartiges Interesse an dir entdecken können.“
Hatte Eva auch nicht. Das „Photografünfen“ war die Leidenschaft ihrer Freundin Lea – deren Eltern eine fotographische Lehre entschieden ablehnten. Aber das Gespräch mit ihrem Vater am Vorabend hatte Eva wider Willen umgetrieben. Welche Alternativen gab es, wenn ihr Vater in Sachen Journalismus hart blieb? Lehrerin war keine, fand sie. Unterrichten durften nur unverheiratete Frauen. Eva hatte weder vor, unverheiratet zu bleiben, noch nach einer Heirat jeden Gedanken an Berufstätigkeit aufzugeben. Natürlich unterlag eine verheiratete Frau, die einen Haushalt zu führen und in der Regel auch noch Kinder groß zu ziehen hatte, in dieser Hinsicht starken Einschränkungen … Aber, dass es völlig damit vorbei sein sollte, sogar per Gesetz wie im Fall einer Lehrerin, das wollte sie nicht so einfach akzeptieren.
Wenigstens gestattete ihr Vater ihr, mit in die Redaktion zu kommen und verhieß auch, Arbeit für sie zu haben. Draußen war es nicht sehr warm – weniger als 20 Grad – dafür aber schwül. Doch ihr Vater leistete sich für den Weg zur Arbeit immer die schnelle, aber teurere Untergrund-und Hochbahn, die ihn wenig mehr als 15 Minuten von der Charlottenburger Bismarckstraße zur Haltestelle Prinzenstraße brachte, von der es nur noch wenige hundert Meter zur Redaktion waren.
Dort durfte Eva dann die Rätsel der Sonntagsausgabe testen. Der Stadtanzeiger bot seinen Lesern zum Wochenende eine reiche Auswahl an Magischen Drei- und Vierecken, Silben-Scharaden, Rösselsprüngen, Anagramen, Akrostichen, Buchstaben-, Zaun-, Verwandlungs- und Abstreichrätseln. Diese wurden von einer Agentur geliefert, die zwar billig, jedoch auch notorisch schlampig war. „Bringe eine falsche politische Meldung und keiner merkt es. Aber wehe ein Rätsel geht nicht auf … Dann bricht eine Flut von Klagen über dich herein“, meinte Arthur Hoffmann. „Ich bitte also um äußerste Sorgsamkeit bei dieser wichtigen Aufgabe, liebe Tochter.“
Doch Eva ging das Gespräch über den Kronprinzen und die Pogrome noch im Kopf herum. Sie wartete auf eine Gelegenheit, Paul anzusprechen.
„Ich habe noch nie um ein langes Leben für Willem Zwo gebetet. Aber nachdem, was Sie über den Kronprinzen gesagt haben, sollte man es vielleicht doch tun. Meinen Sie wirklich, es wird so schlimm?“, hakte sie nach.
Paul hob die Schultern. „Ich hoffe nicht. Und wenn es schlimm wird, dann ist die große Frage, ob es zum Schaden für ganz Deutschland ist oder nur für die Monarchie.“
Evas Bedenken schlugen sofort in Begeisterung um. „Sie glauben, der Kronprinz könnte eine Chance für die Republik sein? So habe ich das noch nie gesehen.“
„Die Hohenzollern haben 1849 die Krone eines wirklich demokratischen deutschen Staates ausgeschlagen“, erwiderte Paul. „Sie wurden 1871 nicht dank eigener, sondern nur durch Bismarcks Verdienste Kaiser. Ich glaube nicht, dass das Volk ein drittes Mal Nachsicht mit ihnen haben wird.“
„Aber es gibt eine Menge Monarchisten, auch jenseits der Alldeutschen und Stockkonservativen. Sie brauchen doch nur Johannsen anschauen. Oder all die Leute, die mit leuchtenden Augen Hurra schreien, wenn der Kaiser irgendwo vorbei fährt, und begierig jede Neuigkeit von irgendeinem der Prinzen aufsaugen.“
„Das mag sein, solange es uns gut geht“, gab Paul zurück. „Und es geht Deutschland trotz des dauernden Krisengeredes sehr gut. Aber sobald wirkliche Probleme auftauchen, werden die Hohenzollern wahrscheinlich sehr schnell unrühmliche Geschichte sein. Davon bin ich überzeugt.“
Dass ausgerechnet Paul ein derart überzeugter Republikaner war, hätte Eva nicht gedacht. „Sind sie eigentlich auch für das Frauenwahlrecht?“, platzte sie heraus.
Ihr Gesprächspartner musste lachen. „Es wird mit Sicherheit irgendwann kommen.“
„Tatsächlich? Wann?“
„Schwer zu sagen, aber Sie werden es schon noch erleben.“
Inzwischen war auch Theo aufmerksam geworden. „Paulchen, was bist du für ein mieser Verräter!“, warf er seinem Kollegen vor. „Von hundert Frauen haben wahrscheinlich keine drei die geistigen Voraussetzung, die politischen Verhältnisse wirklich zu begreifen. Und die sind dann wahrscheinlich verdammte Radikale. Aber sich vorzustellen, dass alle Marktweiber und Dienstmädchen und braven Ehefrauen, die gerade mal fähig sind, ihr Haushaltsbuch zu verstehen, eine Stimme haben … Da könntest du gleich Affen und Kleinkinder wählen lassen. Das wäre der Untergang.“ Eva öffente den Mund zu geharnischtem Protest, doch Theo war schneller. „Und auch Sie, Evalotte, müssen bei genauer Überlegung zugeben, dass Sie die Mehrzahl ihrer Geschlechtsgenossinnen nicht an der Wahlurne sehen wollen, weil die ihre Stimme garantiert dem nächstbesten hübschen Dummkopf oder Scharlatan geben.“
Eva musste wider Willen an Elschen, Inge und Moritz denken. Trotzdem … Solange Männer alldeutsche Schreier und Antisemiten wählten, sollten die mal schön ruhig sein!
„Ich wette“, setzte jedoch wieder Paul an, bevor sie etwas sagen konnte, „dass der Adel vor 100 Jahren auch lieber sein Vieh als sein Gesinde hätte wählen lassen. Dass die Kinder und Enkel ihrer Knechte und Kossäten mal das Wahlrecht bekommen würden, war für sie wahrscheinlich noch viel unvorstellbarer als für dich das Frauenwahlrecht.“
„Dieses Landvolk, das waren damals ja auch noch alles halbe oder ganze Analphabeten“, argumentierte sein Kollege.
„Der Großteil der Herrschenden damals hielt das gemeine Volk – ob nun Land oder Stadt –aber nicht nur für ungebildet, sondern für gar nicht bildungsfähig. Was ein Irrtum war, wie wir inzwischen bewiesen haben.“
„Was auch für uns Frauen gilt“, nahm Eva die Vorlage begeistert auf. „Nachdem nun die ersten Frauen ihren Doktor gemacht haben und sogar unser rückständiges Preußen vor sechs Jahren das allgemeine Frauenstudium eingeführt hat, kann uns niemand mehr vorwerfen, wir wären nicht bildungsfähig. Und kommen Sie mir nicht mit dem Marktweib, Theo, sonst kontere ich mit dem Bierkutscher“
Theo hatte jedoch keine Lust mehr. „Na, da ist ja wohl doch noch ein Unterschied und noch ist es zum Glück nicht so weit“, maulte er nur und begab sich wieder an seine Arbeit.
Über einen Schritt Österreichs gegen Serbien wurde weiter spekuliert. Er solle noch diese Woche erfolgen. Er sei kein Affront und Eingriff in die serbischen Hoheitsrechte. Es gehe nur um Hilfe bei den Untersuchungen, Garantien gegen die großserbische Propaganda und eine Erklärung der Regierung, die sich von dieser Propaganda distanziere.
Paul studierte die sich widersprechenden Nachrichten der anderen Blätter mit gerunzelter Stirn. "Ich frage mich bloß, aus welchen Quellen die schöpfen! Korresponenten vor Ort müsste man haben. So wie Tante Voss! Der spendiert der Ullstein Verlag ein Korrespondennetz, das sich finanziell nie und nimmer rentiert. Aber sie ist halt die Voss und Aushängeschild des Verlages. Und wir sind auf Wolffs Telegraphenbüro angewiesen, das keine anständigen Informationen liefert. Es ist zum Haareausraufen!“
„Aber wenn es etwas gäbe, dann würde doch auch Wolff das melden?“, vergewisserte sich Eva.
„Nicht unbedingt!", schränkte Paul jedoch ein. "Damit es zuverlässig und billig telegraphieren kann, koopiert Wolff mit der Regierung. Weshalb du aus dieser Quelle eigentlich nichts bekommst, was unsere Regierenden zurückhalten wollen. Was gäbe ich darum, mir selber ein Bild machen zu können, wie die Dinge stehen! Man bräuchte Theos heißgeliebte Flugzeuge. Wenn sie inzwischen bis Madrid fliegen können, müsste es doch möglich sein, damit eben mal nach Wien oder Belgrad zu kommen, um zu erfahren, was dort passiert. Du solltest die Idee mal publizieren, Theo, dass Flieger sich mit Journalisten zusammentun, wenn sie Langstreckenflüge planen und so der Verbesserung der Informationslage dienen.“
Doch sein Kollege war pure Verständnislosigkeit: „Das ist doch wieder mal typisch Paul! Bei dir muss immer alles Sinn und Nutzen haben! Anstatt, dass du einfach begreifst wie fabelhaft es ist, dass es möglich ist, so weit und so hoch zu fliegen.“
Die Kreuzzeitung sammelte auch unverdrossen weiter unflätige, serbische Pressestimmen. Diese protestierten wild gegen die antiserbischen Proteste auf dem Balkan, erklärten, sie würden österreichische Untersuchungsbeamte mit den Spitzen der Bajonette empfangen, behaupteten, Österreichs Regierung sei selber schuld an dem Attentat, ihre Trauer um den Thronfolger nicht echt und den Verhafteten würden im österreichischen Gewahrsam mittels Folter unwahre Geständnisse entrissen. Die Kreuzzeitung erklärte, eine solche Einigkeit weise auf offiziöse Beeinflussung hin und die serbische Presse sei bekanntermaßen so regierungsabhängig, dass ihr Einhalt geboten werden könne, wenn man nur wolle.
Eva holte dazu nochmals Pauls Meinung ein und der erklärte, das wäre Unsinn. „Auch unsere Regierung kann der Presse schließlich nicht einfach gebieten und Serbien hat im Inneren eher noch freiheitlichere Strukturen. Nach allem, was ich weiß, hat die serbische Regierung auch gewaltige Muffe vor einem Putsch der großserbischen Kräfte und lässt diese nur aus Angst gewähren. Wahrscheinlich träumen auch Ministerpräsident Pasic und König Peter im Geheimen manchmal von einem großserbischen Reich, aber sie wollen ihre gegenwärtige Stellung weder dadurch riskieren, dass sie Österreich herausfordern, noch die großserbischen Kräfte, was ein ziemlicher Balanceakt ist.“
Eva fragte sich, über wen sie sich mehr aufregen sollte. Über die serbische Presse oder die Kreuzzeitung. Aber im Grunde waren es natürlich Brüder im Geiste, die sich da befehdeten. Widerliche, chauvinistische, verantwortungslose Hetzer hier wie dar.
Und dann gab es noch Tante Voss, deren Kommentator erklärte, es könne internationale Verwicklungen geben, wenn Serbien wieder mal hinter Rußland und Frankreich Schutz suche. Deutschlands Stimmung sei sehr österreichfreundlich und es sei nicht ratsam sie auf die Probe zu stellen, indem man Österreich an seiner notgedrungenen Verteidigung hindere, etwa Serbien ein Ultimatum zu stellen, das mit der Besetzung Belgrads drohe.
„Das ist doch Wahnsinn“, schimpfte auch Paul. „Ich hoffe, die Idee stammt nur aus den Redaktionsräumen der Voss und nicht aus irgendwelchen k.u.k.-Ministerien. Wenn Österreich wirklich einen solchen drastischen Schritt unternimmt, schaukeln wir uns wieder mal an den Rande eines Krieges.“
„Aber irgendetwas muss Österreich doch tun“, wandte Theo ein. „Die können sich doch nicht einfach ihren Thronfolger abknallen lassen und nichts passiert?“
„Sie haben die Mörder. Sie können sie verurteilen und hinrichten“, gab Paul zurück.
„Aber die Hetze im Hintergrund? Das kann man sich doch nicht gefallen lassen!“
„Ich denke, wenn es eindeutige Beweise gegen Personen oder Gruppierungen in Belgrad gibt, dann ist Österreich durchaus berechtigt, eine Auslieferung oder ein Verbot der besagten Gruppe zu fordern“, mischte sich Evas Vater ein. „Sollte sich Belgrad nicht kooperativ zeigen – was ich nicht glaube, wenn die Beweise wirklich auf der Hand liegen – dann, aber erst dann, wäre ein solches Ultimatum vielleicht wirklich ein Mittel, wenn auch ein riskantes.“
„Ein zu riskantes“, schimpfte Paul. „Ich habe die Schnauze voll von Krisen am Rande eines Weltkrieges.“
„Wenn du dir alles gefallen lässt, dann werden die anderen erst recht frech“, meinte Theo.
„Ich denke“, erklärte beider Chef, „dass es darauf ankommt, dass Österreich so vorgeht, dass die anderen Staaten nicht gut Einwände erheben können. Russland kann Serbien nicht helfen, Fürstenmörder zu schützen. Aber es wird seinen Verbündeten gegen alle überzogenen oder unberechtigt erscheinenden Angriffe schützen. Deshalb will jede Aktion wohl bedacht sein und das lange Zögern stimmt mich hoffnungsfroh, dass man genau das in Wien tut. Dass inzwischen irgendwelche Wichtigtuer mit anderen Vorschlägen aufwarten, das ist nur natürlich. Schade, dass ein Traditionsblatt wie die Voss sich dazu herablässt!“
„Glauben Sie meinem Vater?“, erkundigte sich Eva hinterher bei Paul. „Mit seinem Vertrauen in unsere Regierung und die österreichische? Dass alles vernünftig bedacht wird und kein Anlass zur Sorge ist?“
Paul sah sie entsetzt an.
„Ich erzählte ihm nicht, was Sie sagen“, versicherte Eva schnell. „Aber es ist doch eine Tatsache, dass sowohl in unserer Regierung wie in der österreichischen ein Haufen Stümper sitzen, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern ganz ausdrücklich die von meinem Vater. Aber auf einmal kann er nicht genug tun, sein Vertrauen zu beteuern, dass alle vernünftig handeln werden. Warum sollten sie sich plötzlich so geändert haben?“
Paul hob die Schultern. „Es gab die Krise von 1912. Das sollte eigentlich allen Beteiligten eine deutliche Warnung gewesen sein, in Zukunft besonnener zu handeln.“
„Und? Glauben Sie das sie es tun werden?“
Erneutes Schulterzucken: „Ich hoffe es!“
Als Eva und ihr Vater am Abend nach Hause kamen, fanden sie Magda Hoffmann in nicht geringer Aufregung vor. Evas Retter vom Dienstag hatte seine Aufwartung gemacht, um sich zu erkundigen, ob die Gerettete sich wohl befinde und das Abenteuer gut überstanden hatte. Überaus freundlich und höflich sei der Gast gewesen, berichtete sie. Und was für schöne Blumen er mitgebracht habe. Und wie enttäuscht er gewesen sei, Eva nicht vorzufinden. Dieser Enthusiasmus animierte ihren Gatten sofort zu der bissigen Frage, ob da nicht ein Mitgiftjäger fette Beute wittere. Von seiner Tochter wollte er wissen, ob sie dem windigen Burschen gegenüber erwähnt habe, dass ihr Vater Inhaber einer Zeitung sei, und von seiner Frau, ob sie auf verdächtige Anzeichen geachtet habe wie abgewetzte Manschettenränder oder Mottenkugelgeruch, der vom einzigen guten Anzug ausging. Worauf Magda Hoffmann empört erwiderte, der junge Mann sei als Jurist bei der Deutschen Bank tätig und unter anderem mit den Geigers und den Buschs bekannt. „Ein Bankangestellter! Und noch dazu Paragraphenreiter“, rief Arthur Hoffmann in einem Ton aus, der auch gut zu „Bierkutscher! Lumpensammler!“ gepasst hätte, und gab vor, sich nicht an die Geigers und die Familie Busch zu erinnern, die zugegebenermaßen keine allzu nahen – aber doch höchst respektable – Bekannte waren. Eva stand dazwischen und fühlte sich komisch. Über dem ganzen Gekakel von Vater und Mutter wusste sie selbst nicht mehr, ob sie das Wiederauftauchen ihres Retters eher bedenklich oder schmeichelhaft finden sollte.
„Ich habe ihn jedenfalls für Sonntagnachmittag zum Kaffee geladen“, erklärte Magda Hoffmann.
Samstag, der 11. Juli 1914
Nach drei kühlen, bedeckten und windigen Tagen präsentierte sich der Samstag wieder heiter und mit Temperaturen über zwanzig Grad. Es gab auch keine Nachrichten, die die Stimmung trübten. Freilich: Der albanische Fürst Wilhelm rief weiter vergeblich die europäischen Mächte um Hilfe in seiner bedrängten Lage. In Mexiko schien Präsident Huerta am Ende. Die letzten Präsidentschaftswahlen sollten annulliert werden und Huertas erst 38 Jahre alter Außenminister Carbajal wurde schon als sein Nachfolger gehandelt. Und außerdem war Nikolaus Hartwig, der russische Gesandte in Serbien gestorben. Er hatte bei einem Zusammentreffen mit dem österreichischen Gesandten Baron von Giesl einen Herzanfall erlitten. Die Kreuzzeitung frohlockte unverhohlen. Hartwig sei ein Renegat gewesen, ein erbitterter Feind des Habsburgerreiches, ein Garant für Schwierigkeiten in der gegenwärtigen Krise gewesen. Sein Tod könne nur als Entspannung gewertet werden.
Eva dachte sich wieder mal, wie die Kreuzzeitung toben würde, wenn ein ausländisches Blatt so über einen deutschen Gesandten gesprochen hätte und ihr Vater meinte süffisant: „Wie aufrichtig nach solchen Ergüssen die offiziellen deutschen Beileidstelegramme der russischen Regierung und Bevölkerung in den Ohren klingen werden?“
Sonntag, der 12. Juli 1914
Der erwartete Besuch hielt Eva nicht vom ausführlichen sonntäglichen Zeitungsstudium ab. Dem immer noch im Zeichen des Ausverkaufs stehenden Anzeigenteil schenkte sie wenig Beachtung und registrierte nur kurz, dass Wertheim Damenkleider von 9 bis zur unglaublichen Summe von 138 Mark im Angebot hatte und in der Kaufhauskette Jandorf am Montag die 39-Pfennig-Woche beginnen würde, wo man etwa 100 Reissnägel, ein Paar Strumpfhalter, vier Milchtöpfe oder eine Tändelschürze für diesen Betrag erstehen konnnte. Doch Berichte zur gegennwärtigen Krise fanden sich nur spärlich. Paul Michaelis, der politische Redakteur des Berliner Tageblatts, hielt die österreich-serbische Angelegenheit in seiner Wochenschau keiner Erwähnung mehr wert und beschäftigte sich stattdessen ausschließlich mit innerdeutscher Parteipolitik. Auch in den anderen Blättern fand sich kaum etwas. Eine Ausnahme bildete die Norddeutsche, die ein amtliches Wiener Dementi gegen alle angeblichen Augenzeugenberichte brachte, die bosnische Beamte der angeblichen Komplizenschaft mit den Attentätern beschuldigten. Etwa jenen Schriftführer, der angeblich so höhnisch gegrinst habe, dass ein Offizier ihm Prügel androhen müsste. Alles Erfindung, die bosnische Beamtenschaft habe ihren Patriotismus in 36 Jahren bewiesen und sich wiederholt allerhöchste Anerkennung verschafft. Eva fragte sich, ob die offiziellen Wiener Stellen die das Dementi verfasst hatten, damit den Verbalkrieg, der in der Presse geführt wurde, deeskalieren wollten, oder die mangelende Akzeptanz im annektierten Bosnien vertuschen und den Schwarzen Peter ganz Serbien zuschieben.
Eine weitere Ausnahme war wieder einmal Tante Voss. Sie fühlte sich bemüssigt, darzustellen, dass im Augenblick keine Krieg-in-Sicht-Krise wie 1875 im Gange sei. Österreich habe alles Recht auf Forderungen gegenüber Serbien. Das müsse auch Russland einsehen. Unterstütze es Serbien trotzdem – auch auf die Gefahr eines Weltkriegs hin – dann beweise das, dass Russland einen Krieg wolle, egal unter welchem Vorwand.
Allein die Worte Krieg und Weltkrieg bewirkten, dass sich Eva schon wieder der Magen umdrehte. Sie zeigte den Artikel ihrem Vater.
Der runzelte die Stirn: „Ich weiß wirklich nicht, was mit Tante Voss los ist.“
„Kann sie etwas wissen, was wir nicht wissen?“, beharrte Eva.
„Tante Voss hat ein wirklich ausgezeichnetes Korrespondentennetz“, gab ihr Vater zu. „Aber nicht unbedingt exklusiven Zugang zu Regierungskreisen, weder hier noch in Österreich. Dazu steht sie noch immer der Fortschrittlichen Volkspartei zu nahe. Dieser Artikel in der Norddeutschen oder einem anderen offiziösem Organ, das würde mir Sorgen machen. Aber so …“
Ihre Mutter erschien unter der Tür: „Eva, du musst dich noch zurecht machen. Dein Besuch wird bald eintreffen.“
„Moment“, vertröstete diese und überhörte vor allem das Wort 'dein'. „Was war die Krieg-in-Sicht-Krise, Papa?“
Arthur Hoffmann warf einen bedenklichen Blick in Richtung seiner Frau, erklärte dann aber doch. „Frankreich rüstete auf und Deutschland befürchtete eine französische Revanche für 1871. Einige unserer Militärs drängten zu einem Präventivschlag. Bismarck ließ darauf in der offiziösen Post Artikel bringen, die über einen solchen Schlag spekulierten, falls Frankreich die Rüstungen nicht einstelle. Ihm ging es vor allem darum, die Reaktionen der Großmächte, England und Russland, zu testen. Die waren negativ. Bismarck verwarf die Möglichkeit eines Krieges und bemühte sich in der Folge darum, Frankreich diplomatisch zu isolieren.“
„Eva, bitte“, drängte ihre Mutter.
„Aber was meint die Voss, wenn sie betont, dies sei keine solche Krise?“, hakte die nach. „Hat das irgendwer behauptet? Gab es irgendwelche Indizien, dass in irgendeiner Zeitung so ein Spiel gespielt wurde wie damals in der Post?“
„Eva!“
„Ich bin doch schon fast präsentabel, Mama? Sag, Papa, was meint sie?“
„Eva, ärgere deine Mutter nicht! Ich weiß auch nicht, was mit Tante Voss los ist. Sie ist eben schon ein bisschen alt und hat nicht mehr die besten Nerven. Hör doch bitte auf, jeden Zeitungskommentar für bare Münze zu nehmen.“
Eva beschloss, sich damit zufrieden zu geben, und sich doch dem zu erwarteten Besuch zu widmen. Ein passendes Nachmittagskleid hatte sie schon an. Nun überließ sie es ihrer Mutter, ihre Haare zu einer einigermaßen passablen Frisur hochzustecken. Sie wusste immer noch nicht, ob sie den Besuch eher lästig oder schmeichelhaft finden sollte.
Aber er erwies sich als nett. Nett, gut aussehend – worauf sie am Dienstag in ihrem betröppeltem Zustand nicht geachtet hatte – und anscheinend auch humorvoll.
„Es freut mich sehr, zu sehen, dass Sie Ihr Abenteuer unbeschadet überstanden haben.“
„Wandervögel sind zäh“, gab sie zurück, worauf er lachte. Dass er weder etwas gegen Wandervögel noch gegen widerstandsfähige weibliche Wesen hatte, nahm sie als gutes Zeichen.
Sie begann glatt zu bedauern, dass ihr Vater ihn schnell mit Beschlag belegte. Denn es stellte sich heraus, dass er kürzlich einige Monate für die Bank in Mexiko gewesen war, um dort ein Finanzierungsprojekt zu prüfen.
„Oh ja, Mexiko“, rief Arthur Hoffmann aus. „Die politische Situation dort .. Es würde mich interessieren, wie sie das erlebt haben …“ Und schon prasselten Namen und Fakten auf Eva ein, die sie noch nie gehört hatte. Sie ärgerte sich, dass sie in der Redaktion nicht besser aufgepasst hatte, als es um die Unruhen in Mexiko ging. Und Sie hasste es, einfach nur dazusitzen und still zu zuhören, wenn die Männer redeten.
„Ich will nicht unhöflich sein“, nutzte sie endlich eine minimale Gesprächspause. „Aber ich würde gerne verstehen, über was geredet wird.“
Ihr Gast entschuldigte sich sofort vielmals. „Es interessiert sie wahrscheinlich alles gar nicht. Diese ganze Politik!“
„Es interessiert mich durchaus“, stellte Eva klar. „Aber ich muss gestehen: Mexiko … Nach all dem, was gerade auf dem Balkan passiert – das Attentat, Albanien … – , sind mir die Probleme von Präsident Huerta in Mexiko nicht ganz so gegenwärtig.“
„Diese sind auch äußerst kompliziert.“ Ihr Besucher lachte wieder. Offenbar hatte er auch nichts gegen politisierende Frauen. „Ich weiß gar nicht, wo beginnen.“
„Mir scheint, die gegenwärtige Krise fing mit Diaz an“, sekundierte Arthur Hoffmann.
„Das ist wohl richtig. General Porfirio Diaz putschte sich 1876 an die Macht und errichtete – gestützt auf die Grundbesitzer und das Militär – eine stark zentralistische Diktatur. Sein Plan war, mit Hilfe von ausländischem Kapital Mexiko möglichst schnell zu industrialisieren. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Zuckerrohranbau. Doch für den braucht man viel Wasser. Das Wasser gehörte in Mexiko aber schon seit Urzeiten den Dörfern. Es hat immer Streitigkeiten darum gegeben. Doch diesmal wurden sie besonders heftig. Schließlich wollte man in großem Stil und mit modernen, agrarischen Methoden für den Weltmarkt produzieren. Die Großgrundbesitzer begannen mit höchst fragwürdigen, ja eigentlich eindeutig illegalen Mitteln die Land- und Wasserrechte der Dörfer und der meist indianischen Landbevölkerung an sich zu bringen. Zuerst versuchten die sich auf juristischem Weg zu wehren. Als das nichts nutzte, obwohl sie eindeutig im Recht waren, mit Waffengewalt. Daneben gab es auch noch Fälle von Wahlbetrug, und Preissteigerungen bei den Grundnahrungsmitteln auf das Doppelte und mehr. Das Ganze stürzte das Land natürlich ins Chaos. 1910 formierte sich dann unter der Führung eines gewissen Francisco Madero eine Opposition gegen Diaz, die aus Kreisen der Mittel- und Oberschicht stammte. Unterstützt wurde er von zwei Rebellengruppen, den Bauern um Emiliano Zapata im Süden und den Anhängern des Pancho Villa im Norden. Diaz wurde gestürzt und Madero neuer Präsident. Doch nun brachen Konflikte zwischen Madero und seinen Verbündeten aus, da die Volksrebellen weitgehende agrarische und soziale Reformen forderten, als die Madero-Partei gewillt war, durchzuführen. Die Zapatistas stellten ein radikales Pogramm auf, das unter anderem eine teilweise Enteignung der Großgrundbesitzer – allerdings gegen Entschädigung – vorsieht. Madero versuchte sie zu entwaffnen und bezeichnete sie als Verräter an der Revolution. Dann wurde er jedoch selber im Februar 1913 durch den Oberbefehlshaber der Armee, Victoriano Huerta, gestürzt und kam angeblich bei einem Fluchtversuch ums Leben.“
„In Wahrheit war’s natürlich ganz klar politischer Mord“, warf Arthur Hoffmann ein.
Sein Gast nickte zustimmend: „Huerta machte sich zum neuen Präsidenten, hat nun aber nicht nur die Madero-Anhänger gegen sich, die jetzt von Venustiano Carranza geführt werden, sondern auch die Zapatistas und Pancho Villa, der aus dem Exil, in das er sich nach dem Bruch mit Madero geflüchtet hatte, zurückgekommen ist. Im Moment haben die drei ein Bündnis gegen Huerta geschlossen. Villa hat ihn vor gut zwei Wochen in einer unglaublich blutigen Schlacht geschlagen und ich glaube nicht, dass er sich noch lange wird halten können. Auch, dass er, wie gerade gemunkelt wird, zugunsten von Francisco Carvajal, seinem Außenminister, zurücktreten will, wird wenig an der Situation ändern. Carvajal war unter Diaz ein bedeutender Mann. Was aber wird passieren, wenn die ganze Huerta-Clique unter geht? Es steht zu befürchten, dass sich Carranza, Villa und Zapata gegenseitig bekämpfen werden. Gut, Zapata und Villa können sich vielleicht arrangieren, wenn sie ihre Interessensphären abstecken. Denn die Wirtschaft Nordmexikos beruht hauptsächlich auf Rinderzucht, die im Süden auf Ackerbau, die jeweils ihre eigenen strukturellen Probleme haben. Möglicher, dass sie gemeinsam Carranza in die Zange nehmen? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich versucht jeder der drei schon jetzt, eine möglichst gute Ausgangsbasis für die Auseinandersetzungen zu bekommen.“
Montag, der 13. Juli 1914
Unterdessen geriet der Luxemburg-Prozess für Kriegsminister Falkenhayn zum Desaster. Der Vorwärts brachte eine Karrikatur, die den schwitzenden Minister zeigte. Darüber stand „Herrn v. Falkenhayns vermasselte Ferien“. Darunter: „Wat! 1000 Zeugen im Luxemburg-Prozeß! Herrgott von Spandau, hätt ich nur doch bloß nichts angefangen!“ Eine Seite weiter gab es den „Konservativen August“, der schimpfen durfte: „Habe mich offen gestanden nicht wenig geärgert, über die schlappe Haltung der Staatsanwaltschaft im Luxemburgprozeß. Art Rückzug vor frechem Frauenzimmer angetreten. Aber schlappe Haltung schließlich verständlich bei Zivilbehörde, wenn Juristen auch Kavallerie von’s Zivil. Wenn ich Vorsitzender hätte Zeugen der Frima Löwy-Luxemburg ruhig sich ausquartieren lassen. Dann gesagt: Stillgestanden! Hacken zusammen! Jeder brave Preuße weiß, daß Kasernendramen Mumpitz. Gibt nur Kasernenkomödien, die jedes Jahr bei Geburtstag von S.M. von Mannschaften der Kompagnie unter Assistenz von Einjährigen aufgeführt werden.“ Schließlich wurden noch triefend kitschige Idyllen aus einem Buch mit dem Titel „Deutsches Soldatenleben. Patriotischer Roman aus dem militärischen Leben der Gegenwart. Der Wirklichkeit nacherzählt von Robert von Bartsch“ zitiert, die Bruno neidvoll aufstöhnen ließen.
„Das hätte kein Satiriker besser karrikieren können“, gestand er.
In der DTZ dagegen verbreitete Fritz Bley immer noch seitenweise Jauche über die österreich-serbische Angelegenheit. Er empfahl ein 3-Kaiser-Bündnis zwischen Deutschland, Österreich und Russland gegen den Anarchismus.
Die Voss dagegen, über die inzwischen auch die Männer in der Redaktion nur noch den Kopf schütteln konnten, forstete die serbische Geschichte nach Mördern durch, die zu Nationalhelden und Heiligen erklärt wurden, König Stefan Uroš etwa oder der Ritter Miloš, der nach der Niederlage auf dem Amselfeld im Jahr 1389 den siegreichen türkischen Sultan Murad erdolcht hatte.
„Ich möchte die deutsche Volksseele auch nicht am Beispiel der Merowinger festgemacht wissen“, meinte Eva. „Aber dass die Serben 1903 ihren König und dessen Frau bestialisch abgeschlachtet haben, klingt schon sehr scheußlich.“
„Das war es mit Sicherheit“, gab Paul zu. „Andererseits betrieben Alexander und Draga eine skandalöse und politisch hanebüchene Günstlingswirtschaft, dass auch solche, die heute „Köngin Dragas zerfetzten Leib“ zum Beweis serbischer Blutrünstigkeit stilisieren, damals ein gewisses Verständnis für den gewaltsamen Umsturz zeigten. Und wenn andere österreichische Blätter anführen, welche Wohltaten Österreich einst Alexanders Vater Milan erwiesen hat, dann muss man wissen, dass Österreich damit Milans Seitenwechsel von Russland hin zu Habsburg gegen den Wunsch von serbischer Regierung und Bevölkerung erkaufte.“
„Ist König Peter mit dem ermordeten Alexander verwandt?“
„Nein. Er und seine Familie lebten damals im Exil in Paris. Er wurde nach dem Attentat von der serbischen Nationalversammlung zurückgerufen. Ob er eingeweiht war, ist zweifelhaft, aber nicht unmöglich. Gleiches gilt für Pašić, der die folgenden Wahlen gewann.“
„Können die Attentäter von damals auch die Hintermänner des Attentats von Sarajewo sein?“
„Das mit Sicherheit. Zumindest haben weder König Peter noch Pašić gewagt, in irgendeiner Weise gegen die Hintermänner des Attentats vorzugehen. Und sie sind mit Sicherheit im Zentrum der großserbischen Bewegung zu finden. Ob allerdings das Attentat von Sarajewo auch im Zentrum der großserbischen Bewegung geplant wurde oder eher – was ich fast vermute – von einer einzelnen, eher kleinen großserbisch eingestellten Gruppe, ist die große Frage.“
Das Tageblatt vermeldete, dass in England Sufragetten einen Bahnhof niedergebrannt und eine Bombe in ein Postfach deponiert hatten und zählten auf, dass allein im vergangenen Jahr 8 Kirchen, 36 Häuser, 42 Sportgebäude, 23 Schulen, Bahnhöfe und ähnliches sowie 4000 Briefe und 10 Bilder von den Frauenrechtlerinnen zerstört worden waren, was einem Schaden von 8 Millionen Mark entsprach.
Eva erwartete spitze Bemerkungen von Theo. Doch der war ganz in eine großformatige Anzeige versunken, die versprach: „Wie der Teufel fährt man mit Studebaker.“
„Sieht der nicht phantastisch aus“, schwärmte Theo. „Fehlt bloß die Kleinigkeit von 5500 Mark. Naja, 25 PS und 4 Cylinder wollen bezahlt sein.“
Aber Theo hatte trotzdem einen guten Tag gehabt. Die Nachrichtenagenturen vermeldeten einen neuen Weltrekord im Höhenflug von 7500 Metern, aufgestellt durch den deutschen Flieger Heinrich Oelerich, und die deutsche Tennis-Mannschaft hatte sich entgegen anderslautender Gerüchte doch entschlossen, am Davis-Cup teilzunehmen. „Wäre auch eine Schande gewesen, wenn sie sich gedrückt hätten“, meinte Theo befriedigt.
Dienstag, der 14. Juli 1914
Besonderes Objekt von Evas Zorn bei der täglichen Zeitungslektüre war an diesem Tag die Norddeutsche, genauer die Geburtenmeldungen: „Geboren ein Sohn: Hrn. Oberbürgermeister Holbe, Herrn Oberleutnant Sturm, Herrn Rechtsanwalt Rohrmann, Hherrn Staatsarzt Marquart, Eine Tochter Herrn. H. Freiherrn von Richthofen, Herrn Amtsgerichtsarzt Kokolt, Herrn Lehrer G. Krause, Herrn Rechtsantwalt Konrad.“
„Ja, zum Kuckuck“, schimpfte sie für sich. „Welche Naturwunder sind denn das, dass sie und nur sie ein Kind hervorbringen. Das ist doch noch dieser wiederliche, alte Zopf, dass Frauen nur Besitz der Männer sind, und ihnen Kinde gebären, eine Maschine, so wie ihre Druckerpresse ihnen Zeitungen vervorbringt.“
Die DTZ redete in ihrer Mittagsausgabe von „Kriegspanik“ und erging sich dann wieder mal in der Schilderung antiösterreichischer Demonstrationen in Serbien. Gerüchte, in Belgrad sei ein Blutbad an 600 Österreichern geplant, hätten auch zu einer Massenflucht aus der Stadt geführt.
„Kriegspanik!", schnaubte Eva. "Es ist doch gar nichts passiert! Und selbst wenn es Krawalle gegeben hätte, ist das kein Krieg.“
„Aber die Lage in Serbien ist schon ein Pulverfaß“, meinte ihr Vater. „Offenbar geht es in Belgrad und Semlin zu wie im Tollhaus. Erregung, Gerüchte, feindliche Demonstrationen auf beiden Seiten. Da kann leicht etwas passieren.“
Am Abend berichtete die DTZ dann, dass die Beerdigung des russischen Gesandten Hartwig in Belgrad völlig ruhig verlaufen sei. Obwohl es vorher Gerüchtete gegeben hatte, Hartwig wäre bei seinem Besuch beim österreichischen Gesandten Giesl vergiftet worden. „So aufgehetzt können die Belgrader also doch nicht sein“, meinte Eva. Aber aufgrund der Gerüchte hatte es eine Börsenpanik in Wien gegeben. Nun aber war der k.u.k.-Kriegsminister Alexander von Krobatin in den Urlaub gefahren und selbst die DTZ meinte, dass sei ein Zeichen, dass sich die Lage beruhige.
Ansonsten war es ein wieder ein warmer, schwüler Tag mit Temperaturen über 30 Grad und Gewitterneigung am Nachmittag.
Mittwoch, 15. Juli 1914
Der Mittwoch brachte Regen und Abkühlung. Auch politisch. Jedenfalls meinte das die DTZ. Sie redete davon, dass die österreichische Regierung einen Rückzieher gemacht habe und ernsten, kriegerischen Aktionen gegen Serbien Abstand genommen habe.
„Ich bezweifle, dass es jemals solche Absichten gab“, meinte Arthur Hoffmann. „Wahrscheinlich waren alles nur dumme Gerüchte. Wunschdenken der DTZ. Denn, was die gerne hätte, das klingt ja wieder mal klar an: Dreinschlagen! Und jetzt ist man enttäuscht und schmollt! Also gut, die Zuständigen in Wien fahren in den Urlaub und wir ziehen einen Schlußstrich unter die Akte Sarajewo. Aber haben Sie gelesen, Paul, dass Tante Voss meldet, Rasputin sei ermordet worden? Schauen Sie mal, ob die anderen Blätter mehr haben. Das interessiert die Leute."
"Ja, ja, ein russischer Wunderheilermönch ist natürlich allemal wichtiger als der Weltfrieden", maulte der. "Zumindest wird sein Tod nicht zu internationalen Verwicklungen führen."
Dann jedoch kam ein abendliches Telegramm des Wolffschen Telegraphen-Büros mit einer Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten Tisza, der sagte, der geplante Schritt Österreich-Ungarns müsse nicht unbedingt zu kriegerischen Aktionen führen.
„Das sind allerdings neue Töne“, meinte Arthur Hoffmann verduzt. „Bisher klangen die offiziellen Erklärungen aus Österreich eher so, dass überhaupt keine Gefahr bestehe, dass es zu kriegerischen Aktionen kommt.“
„Der Tisza, det is doch een alter Haudejen“, warf sein Chefredakteur ein. „Da darf man nicht allet auf die Joldwaage legen, wat der sacht."
„Oh, im allgemeinen sind alte Haudegen die ehrlichsten Menschen“, widersprach Bruno sofort. „Weil sie Diplomatie und den ganzen Firlefanz für unnötig halten. Wenn man Krieg will, soll man es doch auch sagen. Ist ja nichts Schlechtes dabei.“
„Ich schätze Tisza auch als einen sehr ehrlichen, sehr intelligenten und sehr gefährlichen Mann ein“, meinte Paul. „Einer seiner Vorgänger hat ihn mal mit einem offenen Rasiermesser verglichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht unbedingt etwas gegen einen Krieg hat. Die Frage ist, ob er auch für die anderen Verantwortlichen spricht. Tisza ist nicht die k.u.k.-Regierung.“
„Aber immerhin Ministerpräsident von Ungarn und einer der mächtigsten Politiker des Landes“, erinnerte sein Chef. „Die österreichische Regierung, das ist ein zerstrittener Haufen, nach Franz Ferdinands Tod wahrscheinlich mehr denn je. Aber Ungarn ist Tisza. Er regiert dort wie ein Diktator. Ich würde sagen: Bei unseren Nachbarn geschieht nicht unbedingt, das was der Herr Tisza gerne hätte. Aber es geschieht auch nichts, was ausdrücklich gegen seinen Willen ist. Und deshalb muss man sich schon fragen, ob dort Dinge am Laufen sind, die gefährlicher sind, als wir bisher ahnten.“
„Es ist eigentlich ziemlich einfach“, meinte Bruno. „Wenn Tisza zu Kaiser Franz Joseph oder Außenminister Berchtold zitiert wird, dann hat er sich verplappert und wir sollten anfangen, Vorräte für einen Krieg zu hamstern. Geschieht nichts, dann ist es ihnen ganz recht, wenn Tisza ein bisschen Druck aufbaut, damit Serbien kooperiert, aber geheime Kriegsvorbereitungen gibt es nicht.“
Donnerstag, der 16. Juli 1914
Arthur Hoffmann hoffte, dass seine Tochter Tiszas bedenkliche Äußerung überlesen würde. Er hatte sich entschlossen, die Meldung vorerst ohne Kommentar zu bringen und ebenso waren die meisten anderen Blätter verfahren. Man wollte ja keine Panik ohne Grund und Ursache schüren!
Glücklicherweise blieb Eva an der Nachricht hängen, dass in London nach 23 Jahren wieder gestattet wurde, Ibsens Gespenster aufzuführen. „Wer hätte gedacht, dass wir da fortschrittlicher sind als die Engländer“, meinte sie. Eva las Ibsen mit großer Begeisterung, aber Arthur Hoffmann war es ganz recht, dass sie noch ein wenig zu jung gewesen war, um die beeindruckende Inszenierung mit Alexander Moissi und Agnes Sorma gesehen zu haben, die Max Reinhardt in den Kammerspielen gegeben hatte. Aber spätestens in der nächsten Saison würde es nicht mehr möglich sein, Eva von provokativen, aufwühlenden und skandalösen Inszenierungen fern zu halten. Zwar konnte er es ihr dergleichen schlicht verbieten, solange sie nicht 21 war. Aber das entsprach nicht seinen Erziehungsidealen. Und um zu wissen, welche Aufführungen für ein junges Mädchen eher nicht geeignet waren, musste sie nur Brunos Rezensionen lesen.
Dafür hatte in Mexiko Präsident Huerta abgedankt und sein Vize Carvajal hatte provisiorisch das Amt übernommen. Und Theo war aus dem Häuschen, weil der neue Höhenflugrekord nach neuen Messungen des Leipziger physikalischen Instituts nicht nur 7500, sondern 8100 Meter betragen hatte. „Das ist wirklich unglaublich. Man kann neugierig sein, wie weit das noch geht! Bei Ballonflügen kommt es bei 10.000 Metern zu Bewusstseinstörungen, was natürlich für einen Piloten tödlich wäre. Wenn man noch höher aufsteigen will, müsste man Flugzeuge konstruieren, in denen die Flieger hermentisch eingeschlossen werden.“
„Dann versuchen sie mal, mit einem Konstrukteur darüber zu reden“, forderte Arthur Hoffmann auf.
Freitag, der 17. Juli 1914
Der Freitag erwies sich als ereignisreicher Tag. Aus Russland kamen Meldungen, der obskure Wunderheiler Rasputin wäre nicht, wie die Voss zwei Tage zuvor gemeldet hatte, einem Attentat erlegen, aber doch von einer Frau, die es für ein Gebot Gottes gehalten habe, den falschen Propheten und Mädchenverführer zu töten, schwer verletzt worden.
Bruno bekam eine Anzeige des Unternehmens Dallmann auf den Tisch gelegt: Das warb damit, dass die Münchner Bergkraxler aufgrund ihrer Kola-Pastillen so unermüdliche und frohgemute Sportler seien. Wie die vielen leeren Schachtel, die auf der Zugspitze herumgelägen, bewiesen. „Lassen Sie sich doch mal was zu diesen Naturburschen einfallen, die anscheinend trotz Kola-Pastillen zu schwach sind, leere Schachteln wieder mit ins Tal zu nehmen“, meinte Arthur Hoffmann.
Was Serbien anging, gab es eher beruhigende Meldungen. Britische Zeitungen wie die Times und die Westiminster Gazette meldeten, dass Russland zugesagt habe, alle Forderungen Österreichs, die nicht gegen die nationale Unabhängigkeit Serbiens gerichtet seien, zu unterstützen. Die Briten forderten Serbien nun auf, von sich aus Untersuchungen einzuleiten, und warnten Österreich, den Konflikt nicht mit Gewalt regeln zu wollen.
„Sehr gut“, kommentierte Arthur Hoffmann. „Gut, dass die Briten sich einschalten. Sie sind in Bezug auf den Balkan nun mal die neutralste der Großmächte.“
Der Kommentator der DTZ war allerdings der Meinung, dass die britischen Forderungen ein Angriff auf die nationale Selbstständigkeit Österreichs seien und forderte dessen Regierung auf, alle notwendigen Maßnahmen ohne Rücksicht auf Rußland zu ergreifen.
„Manchmal glaube ich, dass es der DTZ nicht nur an Moral und politischer Weitsicht, sondern auch am elementarsten militärischen Sachverstand mangelt“, schimpfte Paul.
„Was erwartest du von diesen Rübenzüchtern?“, versetzte Bruno. „Hinter der DTZ steht der Bund der Landwirte, nicht das Militär. Die sind natürlich alle Reserveoffiziere und haben Väter, die noch für Preußen gekämpft haben, aber ansonsten kennen sie sich vielleicht mit den aktuellen Getreidepreisen und den Schwierigkeiten, heute noch zuverlässige Erntearbeiter zu bekommen, aus, aber nicht mit mehr.“
Dafür fand Tante Voss wieder zu ihrer liberalen Gesinnung zurück. Ein Gerücht, in Berlin solle ein Sperrstunde um elf Uhr nachts eingeführt werden, kommentierte sie mit einer beißenden Satire, Kräwinkel, Schilda und Schlöppenstadt bräuchten wohl einen Vierten im Bunde. Immerhin sei ein Aufschwung der Nachtmützenindustrie zu erwarten, wenn die Bürger zu später Stunde so der Vormundschaft der Polizei unterstellt werden sollten. Professionelle Tangotänzer würden sich wohl künftig um Erziehungstellen in töchterlichen Häusern bemühen, Kellner sich im diplomatischen Dienst bewerben, da sie geübt seien, in Separees Diskretion zu wahren, die Zigeunerbrimasse der Nachtkapellen würden Klavierlehrer in besseren Familien werden, und überhaupt drohe eine neuer Vormärz, denn wo die Tugend kontrolliert werde, gerate bald auch der Geist unter Kontrolle.
Damit nicht genug, nahm sich Tante Voss, nachdem sie wieder in alten Schwung gekommen war, in einem weiteren Artikel das Verbot vor, außerhalb der Badeanstalten schwimmen zu gehen. Diese Gängelei erklärte sie, beruhe nur auf einer Angst, dass unbekleidet gebadet werde. Dies aber sei in Dänemark und Schweden erlaubt, ohne dass die Moral dort schlechter sei als hierzulande.
Was die auswärtige Politik betraf, meinte die Voss allerdings, eine Lanze für den gestürzten mexikanischen Präsidenten Huerta brechen zu müssen. Natürlich hieß es, der habe Blutspuren auf dem Mantel, aber das hätten seit 100 Jahren alle mexikanischen Machthaber. Aber besiegt worden sei er nur mit Hilfe der USA, da Präsident Wilson ihn nie anerkannt und seine Gegener unterstützt habe. Wilson sei, geschoben von den amerikanischen Trustmagnaten, die in Mexiko investiert hatten, aus barer Hilflosigkeit der skrupeloseste amerikanische Politiker, fand die Voss, und Huerta ein Tatmensch, der jedes Recht gegen den Usurpator von jenseits der Grenze gehabt habe.
„Es ist vielmehr ein Skandal, dass Deutschland Huerta je anerkannt und wohl auch massiv unterstützt hat“, kommentierte Paul wütend. „Und nach allem, was man gehört hat, soll die Ermordung Maderos durch Huertas Leute im Einverständnis mit dem damaligen amerikanischen Botschafter geschehen sein. Wilson gehört vielmehr Anerkennung, dass er damit Schluss gemacht hat.“
Alle Rechte bei der Autorin