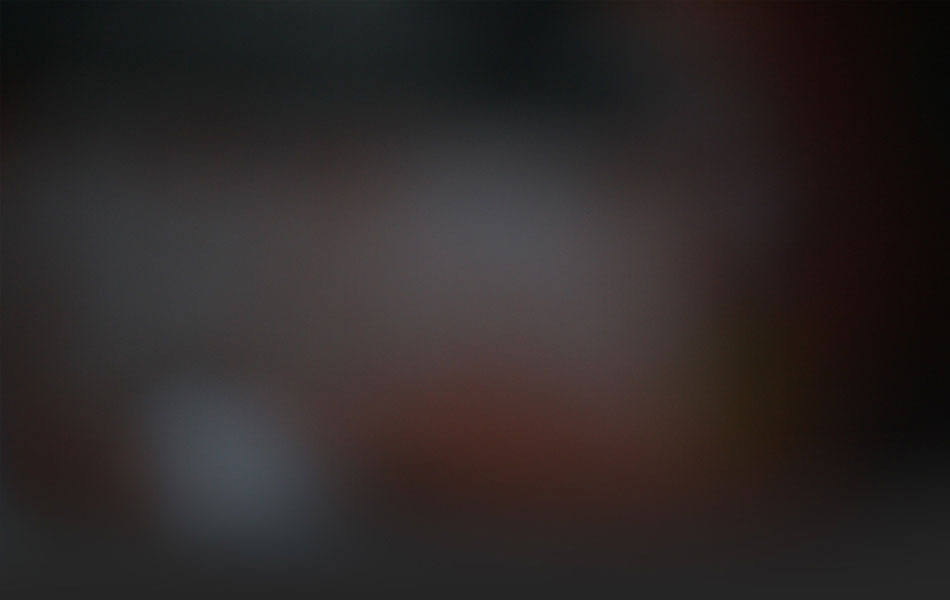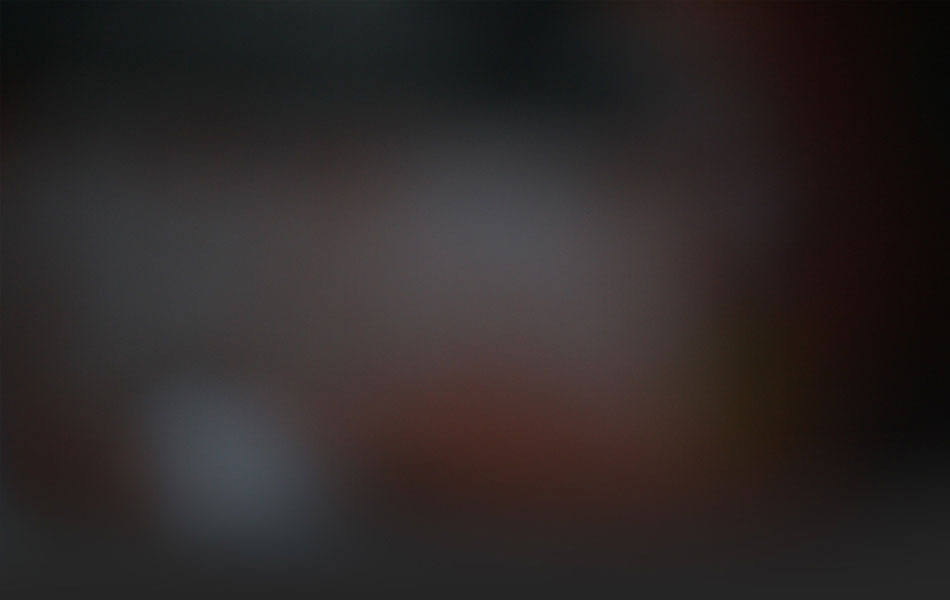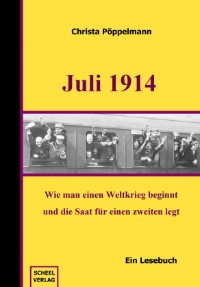
Verkennen, Überheben, Angst: Die schwierige Suche nach den Kriegsgründen
* Drohgebärden & Kriegsszenarien * Weltmacht-Streben * Die deutsche Angst *Widersprüchliche Politik * Gezielte Stimmungsmache * Der alldeutsche Geist * Mythen & Klischees * Verblendung * Verflochtene Ursachen *
+ + + Buch kaufen + + +
Aus heutiger Sicht fällt vielleicht als erstes der Militarismus der damaligen Zeit ins Auge. Deutschland huldigte ihm besonders ausgiebig und rasselte am eifrigsten mit dem Säbel. Aber auch die anderen Großmächte waren keine Waisenknaben. Auch dort gab es heftigen Nationalismus und überall betrieb man eine aggressive, imperialistische Eroberungspolitik, zum größten Teil sogar aktiver und erfolgreicher als das Deutsche Reich, das in erster Linie Pleiten, Pech und Pannen produzierte.
In den Jahren vor dem Krieg aber stieg bei allen Großmächten – mit gewissen Abstrichen auch in England – das Gefühl existenzieller Bedrohung auf. Dies führte dazu, dass die jeweiligen Bündnispartner enger zusammenrückten. Doch ein Mehr an Sicherheit stellte sich dadurch nicht ein. Zum einen führte jegliche Maßnahme dazu, dass das andere Lager sich noch mehr bedroht fühlte und mit Gegenmaßnahmen reagierte. Zum anderen traute man auch den eigenen Bündnispartnern nicht so recht und versuchte ständig, diese enger an sich zu binden, was das Misstrauen auf der Gegenseite noch weiter steigerte. Zu allem Überfluss hörte trotz der prekären Lage keiner auf zu zündeln. Während sich in Europa 50 Jahre später im Kalten Krieg die beiden Blöcke weitgehend bewegungslos gegenüber standen, gehörten expansive Pläne damals zum Selbstverständnis jeder Großmacht. Dabei ging es nicht nur um wirtschaftliche oder sicherheitsstrategische Interessen, sondern auch stark um die „Ehre“. Eine Großmacht, die als solche ernst genommen werden wollte musste fordernd auftreten und sich Respekt verschaffen.
Krieg wurde dabei nicht als „Ultima ratio“, als letztes Mittel der Politik gesehen, auch wenn man diese Floskel schon damals gerne bemühte. Vor allem aber gehörten militärische Drohgebärden zum üblichen politischen Repertoire. So waren die Konferenzen von Berlin 1878 oder London 1913 erst einberufen worden, als die möglichen Kontrahenten schon mit dem Aufmarsch ihrer Truppen begonnen hatten. Vor diesem Hintergrund aktivierte Deutschland eine Zeitbombe, indem es sich auf den Schlieffen-Plan als einzige militärische Option festlegte. Denn nun wurde jede ernsthafte Drohgebärde des Zarenreichs und jede vorsorgliche russische Mobilmachung zum Kriegsauslöser. Die anderen Nationen wussten zwar nichts von dieser Festlegung, aber sie ahnten sehr wohl, dass Deutschland einen derartigen Plan hatte. Angesichts dessen verwundert es nicht, dass die allgemeine Angst, ein Krieg wäre unvermeidlich, immer größer wurde. Doch die Versuche, diese Gefahr zu bannen, waren eher halbherzig.
Zwar führten die Großmächte nach dem deutschen Sieg 1871 keine Kriege mehr gegeneinander. Aber alle Lösungen „am grünen Tisch“ wie die Londoner Botschafterkonferenz waren nur „Feuerwehraktionen“ angesichts akuter Kriegsgefahr. Für eine kurzfristige Entspannung zwischen den Großen wurden dabei regelmäßig die Interessen und Rechte der kleineren Völker missachtet, was dort natürlich Nationalismus und Aggression anfachte. Die Konferenzen mussten aber schon deshalb Flickschusterei bleiben, weil danach wieder Rüstung, Drohgebärden und Kriegsszenarien das politische Denken bestimmten. Die Ideen von Den Haag nahm man nirgendwo sonderlich ernst. Genauso aber, wie das Wettrüsten die Kriegsgefahr steigen ließ, so diskreditierte jede schlecht funktionierende diplomatische Aktion den Gedanken einer friedlichen Konfliktlösung. Namentlich in Deutschland galten Konferenzen 1914 weithin als faule und unbefriedigende Lösungen. Stattdessen sollten die Probleme auf dem Balkan, aber auch das Verhältnis zu den anderen Großmächten „ein für allemal“ und „gründlich“ geklärt werden. Die erwünschte Gründlichkeit schienen aber nur ein Krieg zu bieten oder zumindest eine massive, diplomatische Demütigung des Gegners. Dabei ging man mit bemerkenswerter Naivität davon aus, dass der besiegte oder gedemütigte Gegner in der Folge aufhören würde, ein Problem zu sein. Und dass, obwohl Deutschland seit dem Sieg von 1871 in der Angst vor dem französischen Revanchismus lebte und Österreich-Ungarn vergebens gegen den Panslawismus in den eigenen Provinzen kämpfte. Wie konnte man da glauben, dass ein militärischer Sieg über Serbien den panslawistischen Träumen den Todesstoß versetzen würde? Wie annehmen, Frankreich und Russland würden nach einer Niederlage friedliche und harmlose Nachbarn werden? Andererseits war man damals auch überzeugt, dass Kinder durch Züchtigung bessere Menschen würden. Entsprechend war die Vorstellung verbreitet, dass der politische Gegner seine Lektion schon lernen würde, wenn die nur deutlich genug ausfiel. Man merkte nicht, dass man sich in Wahrheit nicht von rationalen Erwägungen leiten ließ, sondern von dem Wunsch, den Gegner zu strafen. Dabei wurden der Strafe positive Effekte angedichtet, die sie in Wahrheit niemals haben konnte. Wie gefährlich die Illusion ist, einen Gegner durch Demütigung ausschalten zu können, zeigt nichts besser als der „Friedensschluss“ von Versailles. Die harten Bedingungen, hinter denen der verständliche Wunsch der Entente-Mächte steckte, ein für allemal Ruhe vor der deutschen Aggression zu haben, verhinderten den Zweiten Weltkrieg nicht, sondern haben ihn möglicherweise erst verursacht.
Trotzdem ist die Versuchung, sich Krieg als einfache und gründliche Lösung zu denken, seitdem nicht ausgestorben. Nach dem Ende des kalten Kriegs mit seinem Gleichgewicht des Schreckens führte 1990 der Sieg über den Irak, der in Kuwait einmarschiert war, zu einem schnellen, fast unblutigen Erfolg. In der Folge schien direktes, militärisches Eingreifen bei Konflikten wieder eine erfolgversprechende Option. Mehr als zwanzig Jahre und einige Fehlschläge später scheint man die begrenzte Wirkung, die gewaltigen Kosten sowie die oft fatalen Folgekonflikte wieder etwas besser im Blick zu haben.
Schaut man aber wieder zurück auf 1914, dann muss man auch feststellen, dass nicht jede Großmachtpolitik gleich riskant war. So verwirklichten Großbritannien und Frankreich ihre Ambitionen weitgehend in Übersee. Ihre Opfer waren „nur“ Angehörige so genannter „unzivilisierter“ Völker. Diese Betrachtungsweise mag aus heutiger Sicht zynisch erscheinen. Damals empörten Vorkommnisse wie der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Nama und Herero in Südwest-Afrika, die britischen Burenkriege in Südafrika oder die belgischen Kongo-Gräuel, denen schätzungsweise 10 Millionen Menschen zum Opfer fielen, zwar den humanitär eingestellten Anteil der europäischen Öffentlichkeit, zu außenpolitischen Verwicklungen führten diese Verbrechen aber nicht. Anders der russisch-österreichische „Wettstreit“ um die Dominanz auf dem Balkan, und anders auch die Großmachtträume des wilhelminischen Deutschlands mit seinem Streben nach einer Vormachtstellung in Europa und seinem Interesse an überseeischen Einflussgebieten, die bereits andere Mächte für sich reklamiert hatten. Zwar wurde damals (und wird teilweise noch heute) zur „Entschuldigung“ angeführt, Deutschland sei nach seiner Einigung „zu spät gekommen“, aber daraus ein „Recht auf Aggression“ abzuleiten, stellte ein gefährliches, deutsches Hirngespinst dar, für das schon damals niemand Verständnis hatte.
Deutschland hatte aber nicht nur besonders konfliktträchtige Ambitionen, auch die Kriegsgläubigkeit war so ungebrochen wie nirgends sonst in Europa. Für Frankreich war die Niederlage von 1871 ein schwerer Schock gewesen. In der Folge hatte die Zivilgesellschaft dort weit mehr Einfluss als in Deutschland errungen und ihre Armee an die demokratische Kette gelegt. In Russland gab es eine solche demokratische Kontrolle nicht, aber die Spitzen von Militär und Regierung fürchteten seit den revolutionären Unruhen von 1905 einen weiteren allgemeinen Volksaufstand. Außerdem hatte die verheerende Niederlage gegen Japan im gleichen Jahr die Armee des Zarenreichs als Koloss auf tönernen Füßen entlarvt. Großbritannien schließlich hatte all seine Ambitionen bereits verwirklicht. Es regierte ein Weltreich, musste eigentlich keine Angriffe von außen fürchten und stand wirtschaftlich gut da. Dies führte zu einer relativ friedfertigen Europa-Politik, die allerdings auch mit einer beträchtlichen, gerade in Deutschland übel vermerkten Doppelmoral einherging. So entdeckten die Briten bei den Balkanvölkern ihr Herz für das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Für die eigene Kolonialbevölkerung oder die Buren-Republiken in Südafrika galt dies selbstverständlich nicht. Auch sah es Großbritannien trotz aller Friedensbemühungen im Juli 1914 weiterhin als sein gutes Recht an, eine Verschiebung des Kräftegleichgewichts auf dem europäischen Kontinent notfalls militärisch zu verhindern.
Im von Preußen dominierten deutschen Kaiserreich dagegen lebte man in dem Bewusstsein, den beispiellosen Aufstieg von der kleinen, ressourcenarmen Mark Brandenburg zur europäischen Großmacht nur einer überlegenen Armee zu verdanken – mit dem Sieg von 1871 als glanzvollem Höhepunkt. Ohne Kriege zu führen, so die feste Überzeugung, kann ein Staat sich letztendlich nicht behaupten. Militärische Gewalt wurde als alternativlos empfunden. Alle pazifistischen, demokratischen und liberalen Bewegungen hatten es extrem schwer gegen die simple Haltung der Kriegsfreunde: „Recht ist, was Erfolg bringt“. Heinrich Mann meint sogar, der Sieg von 1870/71 habe die wilhelminische Gesellschaft vergiftet. In Kaiserreich und Republik analysierte er 1919:
„Kaum im Genuss seiner Einheit, verleugnete Deutschland die Gedanken der Freiheit und Selbstbestimmung der Völker, worauf all sein Kampf, sein schwärmerischer Drang ein halbes Jahrhundert hindurch sich doch berufen hatte. … Der Sieg von 1870 verlor sich nie in unserem Leben seither. … Er vermehrte sich in unserem Blut wie ein Giftkeim, millionenfach. 1913 waren wir in Handlungen, Gedanken, Weltansicht und Lebensgefühl unendlich mehr Sieger als 1871. Wir waren unendlich prahlerischer und machtgläubiger, unendlich hohler und unsachlicher. … Das unfassbare Unglück eines schrankenlosen, unbeaufsichtigten Sieges ist abzuziehen von unserer Schuld.“
Es wäre jedoch zu einfach, die deutsche Kriegsschuld von 1914 damit abzutun, dass es die Pickelhauben von damals heute nicht mehr gibt. Denn es waren eben nicht die entschiedenen Militaristen und strammen Nationalisten, die die Katastrophe letztendlich beschlossen haben, sondern eher unkriegerische Biedermänner. Doch die Julikrise zeigt, dass solche Politiker genauso gefährlich, manchmal sogar gefährlicher sein können als wilde Kriegstreiber. „Ich denke immer dabei an Monte Carlo“, resümierte der Journalist Theodor Wolff rückblickend. „Wer ist es, der in Monte Carlo Kopf und Kragen verliert? Doch nie der große Spieler, der abgebrühte Klubmann. Der Oberlehrer, den plötzlich der Spielwahnsinn packt, der brave Rentier – das sind die wilden Verlierer.“
Sowohl Bethmann Hollweg wie Moltke verabscheuten und fürchteten den Krieg. Aber gerade ängstliche Menschen neigen dazu, sich Gefahren schlimmer auszumalen, als sie sind. Man denke an die Geschichte vom Mann, der sich vom unfreundlich wirkenden Nachbarn im sechsten Stock einen Hammer ausleihen will. Mit jedem Stockwerk, das er nach oben steigt, malt er sich die Reaktion des Nachbarn schlimmer aus, bis er schließlich – oben angekommen – den Nachbarn wutentbrannt anschreit: „Dann behalten Sie doch Ihren blöden Hammer.“ Doch diese Geschichte ist nur lustig, solange es lediglich um einen Hammer geht, nicht um Gewalt. Denn wenn man da vom anderen nur das Schlimmste erwartet, erscheint eigene Gewaltanwendung leicht als der einzige Ausweg und als ein legitimer noch dazu.
So machte ihre Angst Moltke, Bethmann Hollweg & Co empfänglich für die Idee eines „Präventivkriegs“. „Präventivkrieg“ ist jedoch ein durch und durch verlogener Begriff, ein reines Propaganda-Instrument. Ein Präventivkrieg ist ein Angriffskrieg, der zur Verteidigungsmaßnahme erklärt wird, mit der Begründung, er komme nur einem sicheren Angriff der anderen Seite zuvor. Ob es diesen hypothetischen Angriff aber wirklich gegeben hätte, kann niemals bewiesen werden, da er zwangsläufig durch den „Präventivschlag“ unmöglich gemacht wird.
Auch für 1914 lässt sich nicht beweisen, ob der damals viel beschworene Angriff Russlands und Frankreichs „in ein, zwei Jahren“ wirklich stattgefunden hätte. Vermutlich eher nicht. Denn zwischen dem Zarenreich und Deutschland gab es eigentlich keine militärischen Konflikte, allenfalls das Potential für einen Handelskrieg. Der einzige neuralgische Punkt für die russischen Militärs war eine Verschlechterung ihrer Position auf dem Balkan. Frankreich dagegen fürchtete angesichts der aggressiven deutschen Politik Konflikte und rüstete auf, um reagieren zu können, wohl aber nicht um selber aktiv zu werden. Denn auch die französischen Militärstrategen konnten sich einen erfolgreichen Einmarsch nach Deutschland nur über Belgien vorstellen. Aber in Frankreich war man sich bewusst, dass dies den Bruch mit England bedeuten würde. Und ein Krieg ohne oder sogar gegen die Briten war der französischen Regierung zu riskant. Abgesehen davon hätte jede Kriegserklärung die Zustimmung des Parlaments gebraucht, in dem die Sozialisten und das linke bürgerliche Lager 1914 über eine überwältigende Mehrheit von mehr als 70 Prozent verfügten.
Aber auch wenn die deutsche Angst damals wohl unbegründet war, lässt sich nicht wegleugnen, dass bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Regel die Seite klar im Vorteil ist, die zuerst zuschlägt. Überall, wo reale Furcht vor einem Angriff herrscht, wird stets auch das Bedürfnis aufkommen, diesen Vorteil für sich zu nutzen. Präventiv-Strategien sind deshalb unvermeidliches Beiwerk von krisenhaften Zuspitzungen. Das gilt für Jugendliche, die sich aus Angst vor Angriffen bewaffnen, genauso wie für die große Politik. Etwa wenn man durch einen Angriff auf Afghanistan Osama bin Laden unschädlich machen will. Oder Terrorverdächtige in Guantanamo einsperrt, damit sie nicht eventuell zu Attentätern werden. Deeskalation funktioniert deshalb nicht den ohne Abbau der Angst. Idealerweise sollte sie einsetzen, bevor die Angst so groß wird, dass „präventive“ Maßnahmen als notwendig und gerechtfertigt angesehen werden.
Bemerkenswert an der deutschen Angst von 1914 ist jedoch, dass man zwar einen Überfall Frankreichs fürchtete, sich aber einen Krieg nur offensiv dachte. Niemand kam auf die Idee, sich auf internationaler Ebene um wirksame Garantien für die belgische Neutralität zu bemühen und so eine im Kriegsfall leicht zu verteidigende Westgrenze zu bekommen. Schutz vor französischer Aggression hieß für die deutschen Militärstrategen, im Nachbarland einzumarschieren und es „niederzuwerfen“. Die deutsche Kriegsangst ging also mit einem hochgradigen Aggressionspotential einher, das ein rein defensives Denken gar nicht erlaubte. Und obwohl man die militärische Stärke von Russland und Frankreich so sehr fürchtete, dass man einen Präventivkrieg für gerechtfertigt hielt, hatte man andererseits einen Kriegsplan, der davon ausging, dass man Frankreich in nur sechs Wochen niederwerfen und Russland währenddessen mit geringen Kräften in Schach halten konnte.
Beides ging in der Realität gründlich schief. Während man also die Gefahr, die von der französisch-russischen Allianz ausging, politisch überschätzte, wurde deren Stärke in der Militärplanung völlig unterschätzt. Der Schlieffen-Plan mag 1905 – rein militärisch gesehen – erfolgversprechend gewesen sein, 1914 war er es nicht mehr.
Während sich aber der Generalstab an einen einzigen hochriskanten und zudem veralteten Kriegsplan klammerte, wurde in der Wilhelmstraße eine ebenso eingleisige Politik betrieben. Nachdem die Entscheidung einmal gefallen war, Österreich-Ungarn zu unterstützen, war dieser Kurs für das Auswärtige Amt alternativlos, jeder einzelne Schritt „Notwendigkeit“. Und das, obwohl der „Blankoscheck“ alles andere als durchdacht war. Die einzige wirkliche Direktive lautete „Festbleiben“. Ein Reagieren auf die sich ergebenden Entwicklungen war nicht vorgesehen, ja, wurde als schädlich angesehen. Warum? Stichhaltige Gründe lassen sich dafür nicht anführen. Vermutlich hatten Jagow & Co. vor allem Angst vor den eigenen Zweifeln. Es hätte durchaus Auswege aus der Krise gegeben. Aber alle scheiterten daran, dass die deutsche Regierung den anderen Mächten nicht den geringsten Verhandlungsspielraum einräumte. Mit Ausnahme des kurzzeitigen Umschwenkens in der Nacht zum 30. Juli stand der österreichisch-serbische Krieg nie zur Debatte. Die Entente-Mächte wurde vor die Alternative gestellt, dem Krieg gegen Serbien zuzusehen, oder – so die deutsche Sicht – die Verantwortung für einen Weltkrieg auf sich zu nehmen.
Natürlich muss die Frage erlaubt sein, ob die britischen Kompromissvorschläge wirklich so gut waren, wie sie klangen. Natürlich kann man daran zweifeln, ob bei einer Vier-Mächte-Konferenz viel Substantielles für Österreich herausgekommen wäre oder ob Russland einem Faustpfand-Plan jemals zugestimmt hätte. Aber all diese Fragen können nicht beantwortet werden, weil Deutschland und Österreich gar nicht zuließen, dass sie auf den Prüfstand kamen. Es ist nicht einmal sicher, ob Russland einen österreichischen Angriff auf Serbien mit einer Attacke gegen die Donaumonarchie beantwortet hätte, obwohl es höchstwahrscheinlich so gewesen wäre. Letztendlich gaben die Deutschen den Entente-Mächten gar keine Gelegenheit, am Kriegsausbruch mitschuldig zu werden. Erst torpedierte die Regierung alle Verhandlungslösungen, dann wurde sie von ihren Militärs zur Eröffnung des Krieges gezwungen, noch bevor sich Feinde klipp und klar als Feinde erweisen konnten. Sowohl die Politik der deutschen Regierung in der Julikrise wie auch der Schlieffen-Plan waren für sich genommen abenteuerlich, in der Kombination jedoch hanebüchen.
Politischer Kurs und Kriegsplan widersprachen sich derart, dass man sich fragen muss, ob nicht doch Fritz Fischer Recht hatte: War die deutsche Regierung in der Julikrise vielleicht gar nicht ernsthaft um eine Lokalisierung des Konflikts bemüht? Führte sie kaltblütig und bewusst einen Weltkrieg herbei? Seit 2008 liegt jedoch die mehr als 3500 Seiten starke Biografie Wilhelms II. von John Röhl vor, die akribisch anhand von unzähligen Dokumenten zeigt, wie sehr die Politik unter diesem Kaiser von überforderten und unfähigen Amtsträgern, chaotischen Strukturen und ungeheuren Fehleinschätzungen geprägt war. Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus plausibel, dass die Regierung im Juli 1914 Politik machte, ohne sich um die Vorstellungen der Militärs zu kümmern, während das Militär – das den Krieg ja wollte – die Herren aus der Wilhelmstraße blindlings in die Falle laufen ließ.
Röhls Biografie macht auch deutlich, wie sehr der Fisch vom Kopf her stank. Letztendlich war es der Kaiser, der genau diese Leute berufen hatte, der für die Strukturen, die politische (Un-) Kultur und viele einzelne Fehlentscheidungen verantwortlich war. Es war der Kaiser, der verhinderte, dass sich Menschen mit Format auf wichtigen Posten halten konnten. Es war der Kaiser, der das langfristige Verfolgen vernünftiger politischer Ziele unmöglich machte. Es war der Kaiser, der Deutschland durch sein martialisches Auftreten im Ausland diskreditierte. Und zu guter Letzt war es auch der Kaiser, der am 5. Juli den fatalen „Blankoscheck“ für Österreich ausstellte. Dass seine eigene Regierung später seine Friedensbemühungen unterlief, kann ihn nur teilweise entlasten. Ein Regent mit Führungsqualitäten hätte die Julikrise zur Chefsache gemacht und nicht nur von Potsdam aus ein paar inkonsequente Aktionen gestartet. Natürlich war Wilhelm II. mit seinem Amt überfordert und vermutlich auch durch seine schwere Kindheit traumatisiert. Aber damit hätte er bei Sigmund Freud in Behandlung gehört und nicht an die Spitze eines Staates. Auch solch trübe Tassen wie Zar Nikolaus II. und Kaiser Franz Josef waren den Anforderungen ihres Amtes nicht gewachsen. Ein Blick auf den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist gleichzeitig ein flammendes Plädoyer gegen die Monarchie. Weltgeschichte sollte nicht davon abhängen, ob ein „Erstgeborener“ zufällig das Zeug zum Regenten hat.
Ein anderes Problem waren Presse und öffentliche Meinung. Und das schon lange vor Ausbruch der Krise. Vor allem das rechte Lager startete in seinen Blättern immer wieder aggressiv nationalistische Kampagnen. Selbst wenn es nicht gelang, die aktuelle Politik zu beeinflussen, sorgte diese Stimmungsmache für eine immer feindseligere Wahrnehmung der Deutschen im Ausland. Das führte dort natürlich zu entsprechenden Reaktionen, die die „Warnungen“ der Rechten wieder zu bestätigen schienen. Umgekehrt funktionierte dieser Mechanismus genauso bei Pressekampagnen in anderen Nationen. Selbst ein Scharfmacher wie Kanzler Bülow meinte in einer Reichstagsrede 1909, die meisten internationalen Konflikte der jüngeren Vergangenheit seien erst durch das leidenschaftliche Agieren der öffentlichen Meinung entstanden.
Zudem findet sich in den europäischen Zeitungen eine Stimmung wieder, die immer pessimistischer wurde und den Krieg für unvermeidlich hielt. Diese Annahme machte weite Kreise über die erklärten Militaristen hinaus empfänglich für Aufrüstung und Präventiv-Schläge. Die Gründe für die sich abzeichnende Kriegsgefahr – vernünftige, wie auch absurde, rassistische, sozialdarwinistische etc. – wurden ausgiebig und mit viel Leidenschaft diskutiert. Das ständige Herumreiten auf angeblichen Demütigungen rieb dabei Salz in die nationalen Wunden, bis die „Infektion“ immer weiter um sich griff.
Die Julikrise dagegen wurde von den Journalisten völlig verkannt. Natürlich muss man ihnen zugutehalten, dass ihre Informationsmöglichkeiten weit beschränkter waren als heute. Auch wurden sie von den Regierungen gröblich getäuscht und manipuliert. Aber es bleibt trotzdem festzuhalten, dass die Zeitungen ihren eigentlichen Zweck, nämlich ihre Leser zu informieren, nicht erfüllt haben. Es würde zu kurz greifen, dieses Versagen nur auf die Machenschaften der Politik zu schieben. Die Bereitwilligkeit, die Argumente der Regierung aufzugreifen, war allgemein sehr groß, wie die fast gleich lautende Beurteilung des österreichischen Ultimatums beweist. Überhaupt war das Vertrauen in die eigene Staatsführung gewaltig. Abgesehen von den Blättern der SPD hegte man nirgends Zweifel daran, dass sich Deutschland selbstverständlich mit aller Kraft für den Frieden engagierte und nach Kräften verhandelte. Gerade rechte Blätter wie die Deutsche Tageszeitung erklärten ständig, es verstehe sich von selbst, dass Deutschland friedliebend sei. Das brauche nicht bewiesen werden, sei für jeden vorurteilsfreien Menschen klar, und es wäre unangebracht, dies nochmals zu betonen. Der politische Überblick der deutschen Journalisten dagegen war recht begrenzt. So setzten z.B. viele großes Vertrauen in den Zaren, der bestimmt keine Königsmörder unterstützen werde, und ignorierten dabei alle anderen Kräfte, die in St. Petersburg wirkten. Russlands politische Interessen wie etwa die freie Durchfahrt durch die türkischen Meerengen wurden überhaupt nicht in Betracht gezogen. Auch die eigene Regierung erscheint als recht anonymes Gebilde. So wurden etwa Jagow, Moltke, Tirpitz und Falkenhayn höchstens am Rande erwähnt, Stumm und Zimmermann überhaupt nicht. Der mangelnde politische Weitblick führte auch dazu, dass die Krise von der Presse anfangs total unterschätzt wurde. Zwar wurde vor dem 23. Juli ständig über einen Schritt Österreichs spekuliert und im Grunde hatte man auch alle Forderungen schon diskutiert, die später erhoben wurden. Aber das geschah ohne jede Aufregung und nur in kleinen Randnotizen. Danach überschlugen sich die Ereignisse, so dass selbst die Zeitungen, die kritisch zu sein versuchten, davon überrollt wurden. Während einzelne Kommentatoren direkt nach dem Bekanntwerden des Ultimatums noch forderten, Österreich müsse seine Anschuldigungen beweisen, und die Punkte müssten Gegenstand von Verhandlungen sein, wurde dieses Anliegen in der Folge einfach fallen gelassen. Auch das Argument, die russische Mobilmachung sei in einer derartigen Krise normal, hielt dort, wo es überhaupt vorgebracht wurde, gerade mal einen Tag. Je näher die Kriegsgefahr rückte, desto mehr wuchs erkennbar die Angst, mit einer kritischen Berichterstattung und politischen Forderungen nur dem Feind in die Hand zu spielen. Ab dem 30. Juli unterschieden sich die Blätter von Rechtsaußen bis gemäßigt Links kaum noch. Nur die radikal Linken wie die Redakteure des Vorwärts, die der deutschen Regierung aus Prinzip misstrauten, glaubten nicht an das Märchen von der deutschen Unschuld, wurden aber bald durch die Zensur mundtot gemacht.
Doch so wie die Presse nicht nur Opfer der Politik war, so war das Volk nicht allein Opfer der Presse und ihrer falschen Informationen. Emil Ludwigs Aussage „Die Gesamtschuld lag in den Kabinetten, die Gesamtunschuld auf den Straßen Europas“ stimmt nur in so weit, als dass auch eine kritische Öffentlichkeit im Juli 1914 vermutlich nichts an den Entscheidungen der Politiker und Militärs geändert hätte. Aber größtenteils war die Öffentlichkeit eben nicht kritisch. „Dieses arme Volk ist … belogen worden vom ersten ‚Wir sind überfallen’ bis zum letzten ‚Wir sind nicht besiegt’“, konstatierte Heinrich Mann in Kaiserreich und Republik, fügte aber hinzu: „Ach! Wäre es nur nicht ganz so reif gewesen, sich auch selbst zu belügen.“ Er sah eine überhebliche Geisteshaltung, die die ganze wilhelminische Gesellschaft prägte. „Das ‚Alldeutsche’ war … die Seele der Epoche. Vergebens nannte man sich konservativ oder liberal, vergebens zierte sich die Regierung: zuletzt geschah immer, was alldeutsch war, – bis an das tödliche Ende“, konstatierte er. „Kein Bedarfsartikel erschien, damit er nur gut sei; er hatte ‚deutsch’ zu sein und irgendwie ‚an der Spitze’ zu stehen. … ‚Ein ewig dauernd Herrenvolk’ verlangten sie von euch – und das war schlechthin grauenvoll. … Der Untertan verzichtete … darauf, die immer wiederholten Kriegsdrohungen seines mit ihm verschmolzenen Kaisers für Verirrungen eines Einzelnen zu halten. Wilhelm der Zweite hat jedes Mal ungehemmt nur herausgesagt, was im Hintergrund jedes Bewusstseins war…: zuletzt sind wir der Sieger. Wir dürfen uns überall verhasst machen, brauchen über die Völker, mit deren Hilfe wir reich werden wollen, kein wahres Wort zu wissen …Der Sieg, unser gottgewolltes Amt, gibt uns das Recht auf alle Fehler, jeden Übermut.“ Über den Krieg urteilt Heinrich Mann schließlich: „Sie haben ihn nicht gewollt. Sie haben nur so gelebt, dass er kommen musste.“
Damit liegt er nicht weit entfernt von Kanzler Bethmann Hollweg, der bereits im Februar 1915 in einem Gespräch mit dem Journalisten Theodor Wolff sagte: „Der Krieg ist doch nicht aus diesen einzelnen diplomatischen Aktionen entstanden, er ist das Ergebnis von Volksströmungen – und da haben wir unser Teil der Schuld, haben diese Alldeutschen ihre Schuld. Wir haben ja in unserer inneren und in unserer äußeren Politik in Lügen gelebt. Ein schreierischer, überforscher, renommistischer, schwatzhafter Geist war durch diese Alldeutschen in unser Volk getragen worden …. Es war ja eine Aufgeblasenheit, ein völliges Verkennen bei diesen Leuten. Alle anderen Völker taugen nichts, nur wir. Und diese Schlagworte … am deutschen Wesen soll die Welt genesen … aber was würden wir sagen, wenn die Engländer oder die Franzosen so was von sich behaupten wollen? … Unsere Professoren haben ganz versagt, die Großindustriellen sind ganz fürchterlich. Männer wie Kirdorf und Stinnes – die möchten ja auch die halbe Welt.“
Auch wenn es Bethmann Hollweg leugnet, war der Krieg natürlich das Resultat der diplomatischen Aktionen. Aber ohne dieses „völlige Verkennen“, ohne den schreienden Gegensatz, wie hoch man in Deutschland die eigenen Interessen hängte und wie gering das Verständnis für die der anderen Seite war, lässt sich die gesamte Wilhelminische Politik nicht erklären, ist nicht zu verstehen, warum ein eigentlich intelligenter und zurückhaltender Mensch wie Bethmann Hollweg der Welt den Krieg erklärte. Nur vor diesem Hintergrund kann man begreifen, warum die serbische „Ablehnung“ des Ultimatums und der Kriegsausbruch von Tausenden überschwänglich gefeiert wurden, und weshalb es nach dem Krieg so wenigen gelang, die deutsche Verantwortung anzuerkennen.
Natürlich ist egozentrisches Verhalten in gewissem Ausmaß normal. Fast jeder sieht leichter die eigene Benachteiligung, hängt seine eigenen Belange höher als die der anderen. Jeder steht im Supermarkt in der Schlange, die am längsten braucht. Unzählige Gespräche scheitern daran, dass jeder im Grunde nur Verständnis für die eigene Position sucht, während die Argumente des Anderen kaum wahrgenommen werden. Aber was sich im Bewusstsein der Deutschen am Vorabend des Ersten Weltkriegs abspielte, hatte eine andere Dimension.
Dabei war Deutschland die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, stand wissenschaftlich und kulturell glänzend da und war militärisch jedem einzelnen seiner Nachbarn überlegen. Und trotzdem hatte man das Gefühl, die anderen Großmächte würden einem nicht „die Luft zum Atmen“ lassen. Was wollte man eigentlich noch? Die Antwort ist so einfach wie vermessen: Alles! Jeder Wunsch wurde im Handumdrehen zur „Notwendigkeit“. Die Deutschen der wilhelminischen Ära meinten, sich erst sicher fühlen und zufrieden geben zu können, wenn sie absolut dominant waren. Ihre Furcht vor einem Krieg und seinen Folgen war weit geringer als die Angst, was eventuell passieren könnte, wenn man zu friedfertig agierte und nicht gut genug gerüstet war. Der Anspruch auf eine Vormachtstellung wurde damit begründet, ein dominantes Deutschland sei eine Garantie für den Frieden Europas. Denn natürlich war man überzeugt, diese Macht nicht zu missbrauchen – eine Haltung, die man den „anderen“ nicht ansatzweise zutraute.
Dabei wählte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht deutsch-national. Überdies war die Regierung Bethmann Hollweg in der Öffentlichkeit spätestens seit der Zabern-Affäre angezählt. Der Kaiser war im Grunde unbeliebt, das Gebaren des Militärs ein wachsendes Ärgernis und der Hurrapatriotismus der Alldeutschen vielen peinlich. Doch mit Kriegsbeginn löste sich all das in Luft auf. Die große Zustimmung zum Krieg zeigt, dass die Menschen ihrer Regierung offenbar genau in dem Moment nicht mehr misstraut haben, als wirklich große Gefahr drohte und eine kritische Haltung besonders angebracht gewesen wäre. In einer extrem angespannten Lage wie in den letzten Julitagen 1914 scheint der Gedanke einfach unerträglich, die eigene Regierung könne anders als friedfertig, verantwortungsvoll und vertrauenswürdig sein. Sollte dies aber der Normalfall sein, so wäre es eine Illusion zu glauben, dass Bevölkerungen Kriege verhindern können. Es mag Revolutionen geben, wenn diese schlecht laufen. Zu Beginn aber wird erst einmal Burgfrieden geschlossen, weil kaum jemand sich dem Gefühl entziehen kann, dass die größere Gefahr durch den äußeren Feind droht und nicht von innen kommt.
Die Art und Weise, wie große Teile der deutschen Bevölkerung den Kriegsbeginn begrüßten, kann aber nicht nur auf die Lügen der Regierung zurückgeführt werden und den Wunsch der Öffentlichkeit, ihr zu vertrauen. Sie macht auch deutlich, welche Macht von Mythen und Klischees ausgeht, wenn der Verstand erst einmal ausgeschaltet ist. Man glaubte die Lügen über den angeblichen „Überfall“ auch deshalb, weil man ja „wusste“, dass der Franzose heimtückisch, der Italiener treulos, der Engländer ein eiskalter Krämer und der Russe grausam ist. All diese Vorurteile, über die Jahre gehegt und gepflegt von strammen Nationalisten und kriegslüsternen Militärs, wurden plötzlich auch von Leuten nachgeplappert, die sich selber keineswegs als „alldeutsch“ sahen. Aber die Tatsache, dass diese Einschätzungen weit verbreitet und sattsam bekannt waren, verlieh ihnen plötzlich Glaubwürdigkeit.
Es braucht jedoch keinen Krieg dafür. Auch heute noch führen Verdikte aus längst vergessenen Zusammenhängen ein scheinbar unausrottbares Eigenleben. So scheint keine gegenteilige Statistik dem Spruch „Frau am Steuer“ je etwas anhaben zu können. Und trotz der Vorliebe für polnische Handwerker, Putzfrauen und Pflegekräfte ist es hierzulande noch nicht gelungen, den bösen Spruch über die „polnische Wirtschaft“ zum Verschwinden zu bringen, mit dem Friedrich der Große 1772 die Annexion des polnischen Westpreußen zu rechtfertigen suchte.
Die Beispiele aus der Gegenwart mögen harmlos wirken, doch die mentalen Abgründe, die sich zu Kriegsbeginn 1914 plötzlich auftaten, waren erschreckend. Sie zeigen wie Vorurteile und Bosheiten, die zuvor eher gedankenlos gebraucht worden sind, unter dem Gefühl der Bedrohung zu ideologischen Waffen werden und unbegründeten Hass schüren. Anstelle rationaler Argumente tritt plötzlich eine Horrorversion von Grimms Märchenstunde, wo Gut und Böse säuberlich getrennt sind. Jeder hat seine zugewiesene Rolle, am Ende siegt immer die richtige Seite und mit dem Satz „Wenn sie nicht gestorben sind …“ sind alle Probleme gelöst.
Alfred Hermann Fried (1864–1921), der Mitbegründer der Deutschen Friedensgesellschaft und Friedens-Nobelpreisträger von 1911, klagte am 9. August 1914 in seinem Tagebuch: „In den Zeitungen ist jetzt gerade das Gegenteil von dem zu verspüren, was Nicholas Murray Butler [US-Philosoph] als den ‚internationalen Geist’ definiert hat. Das ist die Kunst, sich in die Anschauung eines anderen Volkes hineinzuversetzen, es von seinem eigenen Standpunkt aus zu verstehen versuchen. Wie weit ist man heute von dem entfernt! Mit aller Kraft sucht man dazutun, dass die Handlungen des Gegners verrückt, perfid, ehrlos sind. Es wird jede Handlung eines einzelnen übertrieben und der Gesamtheit vorgeworfen. Alle Kulturtaten eines Volkes zählen nichts, sind vergessen, wenn man ihm nur eine einzelne unfaire Handlung vorwerfen kann.“
Vielleicht am erschreckendsten ist, wie sich plötzlich auch die intellektuelle, deutschsprachige Elite in der Verherrlichung der Gewalt gefiel. Koryphäen wie Gerhart Hauptmann, Rainer Maria Rilke, Frank Wedekind, Hugo von Hofmannsthal und – besonders vehement und in krassem Gegensatz zu seinem hellsichtigen Bruder Heinrich – Thomas Mann begrüßten den Krieg als Heilsbringer, der Schlaffheit, Dekadenz und alle sonstigen Zivilisationsübel beseitigt. Dabei griffen sie auch auf einen weiteren, lang gehegten Mythos zurück. Denn während die Deutschen von ihren Nachbarn gerne als wilde Teutonen wahrgenommen wurden – martialisch, gefühlskalt und unzivilisiert –, bescheinigten sie sich selbst eine besondere Gefühlstiefe sowie eine Extra-Portion Gemüt, Friedfertigkeit und Langmut. Man sah sich allen Ernstes als gutmütigen „deutschen Michel“, der nur im äußersten Notfall zur Gewalt greift. Dann aber muss er siegen, da seine Beweggründe echter, ehrlicher und gerechter, ja „heiliger“ sind als die seiner Nachbarn. So behauptet Thomas Mann in seinem während des Krieges verfassten 600-Seiten-Traktat Betrachtungen eines Unpolitischen: „Friedensliebe und Kriegertugend seien darum in der Natur der Deutschen so wohl [gut] vereinbar, weil ihr Soldatentum nicht aus Gloiresucht entspringe, nicht Ausdruck einer kecken, brillanten und bravurösen Rauf- und Attackierlust sei, wie ehemals das der Franzosen … – sondern moralischen Wesens, ein Heldentum im Namen der ‚Not’, eben jener ‚heiligen Not’, in deren Zeichen vom ersten Augenblick an für die Deutschen dieser Krieg stand.“
Den Weltkrieg sah Thomas Mann als Verteidigung der tieferen und echteren deutschen Kultur gegen die angeblich nur oberflächliche Zivilisation der europäischen Nachbarn. In einem Brief an seinen Bruder Heinrich vom 18. September 1914 spricht er von einem „großen, grundanständigen, ja feierlichen Volkskrieg“.
Auf den Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte diese Verblendung sowohl der Intellektuellen wie der Massen allerdings noch keine Auswirkung, auch wenn sie ihn schrill begleitete. Aber sie führte dazu, dass ein (zu) großer Teil der Deutschen aus diesem Lügen-Märchen nie wirklich erwachte, nie ein Verhältnis zur Weimarer Republik fand und aus dem Gefühl gekränkter Unschuld heraus, den ersten demokratischen deutschen Staat einer noch viel größeren, noch viel schrecklicheren Verblendung opferte. Viele ließen sich sogar einreden, die Juden seien schuld an Kapitulation und „Versailler Schanddiktat“, obwohl es wirklich schwer fällt, bei beiden Ereignissen Beteiligte jüdischer Herkunft zu finden. Aber auch die antisemitischen Vorurteile waren eben schon vorhanden und wurden seit jeher gerne genutzt, wenn Bedarf an Sündenböcken bestand.
Vielleicht wären die Dinge anders verlaufen, wenn die Verantwortlichen der Julikrise später zugegeben hätten, dass sie damals die Öffentlichkeit getäuscht hatten. Aber dazu hätten sie sich ihre Tricks und Unwahrheiten erst einmal selber eingestehen müssen. Und selbst dann wäre es ihnen ein Leichtes gewesen, Rechtfertigungen zu finden. Schließlich waren sie 1914 überzeugt gewesen, unbedingt „Festigkeit“ gegenüber dem Ausland demonstrieren zu müssen. Eine solche Haltung würde aber nicht den gewünschten Eindruck erzielen, wenn man ganz offensichtlich nicht einmal das eigene Volk hinter sich hat. Auch lässt sich schlecht mit Erfolg ein Krieg führen, wenn ein Großteil der Bevölkerung ihn ablehnt. Deshalb hätte in so einer Situation wohl fast jede Regierung der Welt gelogen, um die eigenen Reihen zu schließen. Und warum sollte man nach dem Krieg die Wahrheit sagen, wenn sie eigentlich keiner hören wollte? Vor diesem Hintergrund mag das Schweigen der deutschen Politiker verstehbar sein. Aber die Folgen waren fürchterlich.
Will man wirklich etwas aus der Geschichte lernen, dann geht es weder darum, die Verantwortlichen von damals zu beschuldigen, noch sie in Schutz zu nehmen, sondern darum zu verstehen, aus welchen Problemen und Fehlern solche Katastrophen entstehen. Dazu aber muss das ganze Geflecht unter die Lupe genommen werden: die deutschen Politiker, die zwar den Krieg ausgelöst haben, aber auch Opfer der Fehler ihrer Vorgänger waren, der katastrophalen Strukturen und der fatalen wilhelminisch-alldeutschen Mentalität; der Kaiser, der nicht nur als Person Fehler gemacht hat, sondern schon aufgrund seiner Stellung ein Problem war; die Militärs, die den Krieg wollten, ihn teilweise aber als einzigen Ausweg aus einer existentiell bedrohlichen Situation ansahen; schließlich die deutsche Presse und das deutsche Volk: Belogen und Betrogen, aber auch bereit, sich belügen zu lassen, Mitschöpfer des Märchens vom „armen, zu kurz gekommenen Deutschland, das doch wohl für seine Rechte kämpfen darf.“
Man sollte es auch nicht bei dem einfachen Urteil belassen „Deutschland war schuld“, nur weil die deutsche Führung zweifelsfrei den Weltkrieg begonnen hat. Mitschuldig ist natürlich auch Österreich-Ungarn, obwohl es „nur“ eine Abrechnung mit Serbien gewollt hat. Die aber wollte es um jeden Preis und welche Konsequenzen daraus erwachsen konnten, scheint den Verantwortlichen in Wien herzlich egal gewesen zu sein. England, Frankreich, selbst Russland betrachtete man in erster Linie als Problem der Deutschen. „Wenn der Weltkrieg daraus entsteht, so kann uns das gleich bleiben“, soll Außenamts-Mitarbeiter Hoyos am 15. Juli dem Abgeordneten Josef Redlich (1869–1936) gesagt haben.
Schaut man aber über die Julikrise hinaus, dann waren auch die anderen Beteiligten nicht nur Opfer. Serbien: Wie alle Balkanvölker Spielball der Interessen der Großmächte, aber auch von heftigem, hochaggressiven Panslawismus geprägt, der alle Südslawen, ob sie wollten oder nicht, für die eigenen Großmachtträume in Geiselhaft zu nehmen versuchte. Russland: Beherrscht vom fixen Gedanken, die türkischen Meerengen unter ihre Kontrolle zu bringen, und dafür immer wieder bereit, auf dem Balkan zu zündeln. Großbritannien: in seiner Doppelrolle als größte Kolonialmacht und Schiedsrichter über das Gleichgewicht Europas nicht wirklich glaubwürdig und für das deutsche Kaiserreich eine ständige Provokation. Frankreich: Zwar ohne Angriffsabsichten, aber von der irrigen Meinung besessen, Deutschland durch Aufrüstung und Drohgebärden einschüchtern zu können. Nicht ganz vergessen sollte man auch Italien, das 1912 mit seinem Angriff auf Libyen die Balkankrise samt der daraus folgenden Eskalation ausgelöst hatte, im Juli 1914 aber keinerlei Versuche zur Beilegung der Krise machte.
Natürlich gab es auch Leute, denen man beim besten Willen keinen Opferstatus zuerkennen möchte: die „echten Alldeutschen“ und diejenigen Militärs, die im Generalstab und in den einschlägigen Vereinen und Verbänden schon seit langem auf einen Krieg hingearbeitet und die Angst ihrer Landsleute erst geschürt hatten. Möglicherweise ließen sich bei genauerer Betrachtung dort noch Drahtzieher finden, denen eine erhebliche, persönliche Verantwortung für den Kriegsausbruch angelastet werden kann. Erich Ludendorff wäre wohl ein heißer Kandidat, auch wenn er 1914 vorübergehend nicht Mitglied des Generalstabs war, vielleicht auch Moltkes Stellvertreter Georg von Waldersee. Aber was wären solche Figuren ohne Anhänger, die ihnen Glauben schenken? Sie an den Pranger zu stellen, befriedigt vielleicht das Gerechtigkeitsgefühl, erklärt aber eher wenig.
Die wahren Gründe der Katastrophe liegen in dem fatalen Dreiklang aus Verkennen, Überheben und Angst. Schuld am Ersten Weltkrieg war das Leben in Scheinwelten, die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten (die dann keine Wahrheiten mehr sind) und die verschiedenen Maßstäbe, die an eigenes und fremdes „Recht“ gelegt wurden, samt der „Märchen“, die man sich zurecht strickte, um dieses zweierlei Maß zu rechtfertigen. Sie führten dazu, dass man das Verhalten und die Interessen der anderen Nationen völlig falsch einschätzte. Fatal erwies sich auch das Überlegenheitsgefühl, das die Deutschen nach dem Sieg von 1871 entwickelt hatten und dann nach Kräften päppelten. Es trug nicht nur erheblich zu diesem zweierlei Maß bei, sondern hatte auch zur Folge, dass Sicherheitspolitik nur vom militärischen Aspekt her gesehen wurde. Da aber die Brust der Akteure oft breiter war als ihre Kompetenz, hatten die deutschen Pläne oft den Charakter von „Milchmännchen“-Rechnungen. Ihren Ängsten jedoch, die mit jedem Misserfolg größer wurden, begegneten die Verantwortlichen genau so, dass die dahinter stehenden Gefahren immer brisanter wurden und schließlich zur selbst erfüllenden Prophezeiung gerieten.
All diese Fehler traten im wilhelminischen Deutschland vielleicht besonders krass auf, sind jedoch keineswegs ausgestorben. Nach zwei Weltkriegen, NS-Diktatur und real existierendem Sozialismus haben wir inzwischen aber verstanden, dass es nicht unpatriotisch ist, die Fehler der eigenen Nation beim Namen zu nennen. Vielmehr obliegt uns die Verantwortung, unsere Geschichte so zu erzählen, wie sie wirklich war, und damit zu verhindern, dass alte Mythen für neues Unheil sorgen. Die Freiheit, dies zu tun, gibt es nicht überall. Wir haben sie. Das ist wunderbar, und wir sollten sie nutzen.
Ende
Copyright beim Verlag